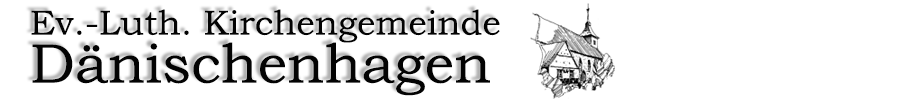01.08.2021
Ferien - nur ein Rad im Leistungssystem?
"Der Glaube hat eine Vorliebe für die Ferien. Das zeigt schon das Wort. Es kommt aus dem kirchlichen Sprachgebrauch. Der gottesdienstliche Kalender spricht nicht von Montag, Dienstag, Mittwoch, sondern sagt: feria prima, feria secunda, feria tertia ... Danach sind offenbar jeden Tag Ferien. Eigenartig. Was soll das bedeuten? Dort, wo die Erlösung zum Zuge kommt, herrscht Freiheit, dort besteht jeden Tag Anlass zum Feiern. Und eigentlich sollte das die Zeit und unser Leben auszeichnen. Wir sind offenbar nicht nur für Schule und Arbeit geschaffen, es gibt etwas darüber hinaus: Ferien. Wie ist das zu verstehen? Der Mensch braucht Erholung. Wir müssen neue Kräfte sammeln, um fit zu bleiben, betriebsfähig und arbeitsfreudig. Wir brauchen Entspannung, um die alltäglichen Spannungen aushalten zu können. Wir brauchen Entlastung, um die Lasten nachher wieder tragen zu können. Ist das alles? Dann hätten also die Ferien lediglich eine Entlastungsfunktion. Die haben sie natürlich. Aber ist das ihr einziger, ihr eigentlicher Sinn? Sie wären dann im Grunde ja doch an der Arbeit orientiert und in den Arbeitsrhythmus eingeplant. Sie wären ein Rad im Leistungssystem: Um leistungsfähig zu bleiben, erholt man sich. Liegt der Sinn unseres Lebens wirklich wesentlich in dem, was wir leisten? Was geschieht dann mit denen, die noch nichts oder nichts mehr oder nicht viel leisten können? Und weiter: Ist das Leben unter dem Druck der eigenen Leistung wirklich sinnvoll? Bleibt man Mensch dabei? Wir können heute sicher vieles machen. Alles können wir nicht machen. Den Sinn unseres Lebens können wir nicht selbst erzwingen. Wir brauchen's auch gar nicht; er ist uns geschenkt. Unser Leben hat seinen Sinn erhalten, bevor wir etwas leisten konnten, und es ist auch dann noch sinnvoll, wenn wir nichts mehr leisten können. Unsere Welt und wir selbst sind bejaht, angenommen von Gott. Darin liegt der Sinn begründet. Von daher könnte man die Ferien ganz anders verstehen. Sie sind dann nicht mehr ein Rad im Leistungssystem, sie stellen es in Frage. Sie weisen uns auf die Freiheit von allen Zwängen hin, die Ziel der Erlösung ist."
(aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke, Jahreslesebuch, hrsg. von Ulrich Schütz, Freiburg 2014, S. 234)
Franz Kamphaus, geb. 1932, war von 1982 bis 2007 katholischer Bischof von Limburg. In diesem Sommer gehören seine Betrachtungen zu meiner Urlaubslektüre.
Peter Kanehls
25.07.2021
Lernorte des Betens
"Dort, wo unser Atem zu flach ist oder zu kurz, wo wir Atembeschwerden haben oder gar in Atemnot geraten, bedarf es entsprechender Übungen. Das gilt nicht minder für das Beten: Was eigentlich selbstverständlich ist, kommt doch nicht von selbst. Die Jünger bitten Jesus: »Lehre uns beten« — schon damals! Beten will gelernt sein, wie eine Sprache, wie die Liebe. Und es will geübt sein in lebenslanger Weiterbildung. Ohne Übung wird keiner Meister. Wo gibt es Lernorte des Betens? Ich habe das Beten nicht so sehr in großen liturgischen Feiern gelernt, sondern in den kleinen Traditionen zu Hause in der Familie, im Morgen- und Abendgebet und im Tischgebet, auch durch das Kreuz, das mir die Mutter immer neu auf die Stirn gezeichnet hat. Das prägt sich ein. Ich kenne junge Eltern, die es mit ihren Kindern heute ähnlich machen. Warum eigentlich nicht? Das Beten muss im alltäglichen Leben Hand und Fuß gewinnen. Ein Pfarrer erzählte mir, ein junger Mann habe ihn gefragt: »Wo lernt man hier eigentlich das Beten?« Er sei bei der Antwort ins Stottern gekommen. Sind unsere Gemeinden Lernorte des Betens? Ich weiß das intensive katechetische Bemühen sehr zu schätzen. Führt es dazu, dass die Kinder und Jugendlichen beten lernen? Sollten in den Gemeinden nicht vorab Gebetstreffen eingerichtet werden, eine Art Gebetsschule? Der Gottesdienst ist ein vorrangiger Lernort des Betens. Indem wir mit der Kirche mitbeten, lernen wir, persönlich zu beten. Und umgekehrt lebt der Gottesdienst mit davon, dass wir lernen, unser Herz ins Gebet zu legen. Wenn einer jemanden wirklich gern hat, bleibt er ihm gegenüber nicht stumm. Ob wir tatsächlich mit Gott rechnen und ihm das Herz zuwenden, zeigt sich in unserem Beten. So ist das heute: Viele von uns beginnen den Tag in Hektik und fallen abends hörfunk- und fernsehgestresst todmüde ins Bett. Wir brauchen dringend Ruhezonen, einen Lärmschutz für die Seele. Der Biorhythmus allein tut's nicht, auch der Gebetsrhythmus bedarf der Pflege."
(aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke, Jahreslesebuch, hrsg. von Ulrich Schütz, Freiburg 2014, S. 233)
Franz Kamphaus, geb. 1932, war von 1982 bis 2007 katholischer Bischof von Limburg. In diesem Sommer gehören seine Betrachtungen zu meiner Urlaubslektüre.
Peter Kanehls
18.07.2021
Du bist mein Atem, wenn ich bete
"Wer nicht betet, ist kurzsichtig. Er bringt sich um seine größten Lebensmöglichkeiten, er bringt sich um die Geschichte mit Gott. Nie sonst findet er so zu sich selbst. Glaube und Vernunft, Gebet und Freiheit schließen sich nicht aus, sondern sind spannungsvoll aufeinander bezogen. Beten macht frei, frei von der Angst um sich selbst, die die Phantasie unserer Liebe verkümmern lässt. Viele Menschen suchen heute Anregungen in der Spiritualität Asiens. Sie sind darauf aus, den inneren Raum ihrer selbst zu erkunden, sich selbst zu verwirklichen mit Leib und Seele. Meditation hat Konjunktur. Gerade nachdenkliche und geistlich wache Menschen finden sich darin wieder. Wer wollte das gering schätzen! Freilich darf dabei das persönliche Gebet nicht zu kurz kommen. Viele denken leider, es sei durch die Meditation überholt. Sie können es einfach nicht glauben, dass der unsagbare Gott uns im Angesicht Jesu Christi begegnet und uns durch seinen Heiligen Geist beim Namen ruft. Meditation ja, Gebet nein — so eine verbreitete Meinung. »Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete«, sagt eines unserer neueren Kirchenlieder (GL 621,3). Was der Atem für das Leben ist, das ist das Beten für den Glauben. Nichts ist uns innerlicher als der Atem. Er ist wie die Lebensenergie, die uns durchströmt. Deshalb hängt viel davon ab, gründlich durchzuatmen. Keine Meditation ohne Einführung ins richtige Atmen. Im Atmen sind wir ganz bei uns, und zugleich stehen wir im lebendigen Austausch mit unserer Umwelt - und mit Gott, dem den Atem verdanken. »Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.« Du bist mein Atem: Da ist ein Gegenüber in deutlichem Unterschied zu mir, und doch ist es mein Atem. Das Beten ist ein Beziehungsgeschehen. Ob Anbetung oder Bitte, ob Lob oder Klage — immer geht es um Ausdruck und Einübung einer lebendigen Be2iehung. Wie jede Beziehung zwischen Menschen ihre Höhe- und Tiefpunkte hat, ihre Seligkeiten und ihre Entfremdungen, so ist es auch für die Begegnung mit Gott im Gebet und in der christlichen Meditation."
(aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke, Jahreslesebuch, hrsg. von Ulrich Schütz, Freiburg 2014, S. 232)
Franz Kamphaus, geb. 1932, war von 1982 bis 2007 katholischer Bischof von Limburg. In diesem Sommer gehören seine Betrachtungen zu meiner Urlaubslektüre.
Peter Kanehls
11.07.2021
Wer glaubt blickt durch
"Not »lehrt beten«, hieß es früher. Lehrt Not beten? Sie hat uns das Planen gelehrt. »Kluger Mann sorgt vor« und die Frau natürlich auch — für die Gesundheit, für das Alter und überhaupt für Lebensrisiken. Wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Wozu da noch beten? Es lenkt doch nur davon ab, selbst etwas zu tun. Nicht die Bitte um jenseitige Hilfe wendet die Not, sondern die diesseitige Tat. So denken viele. Zu einem Rabbi kommt ein Schüler und fragt ihn, was Glauben sei. Der Rabbi führt ihn zum Fenster und fragt ihn: »Was siehst du da?« Der Schüler antwortet: »Ich sehe Menschen, Häuser, Bäume ...« Der Rabbi führt ihn ins Innere des Raumes vor einen Spiegel und fragt ihn: »Was siehst du jetzt?« Der Schüler antwortet: »Jetzt sehe ich mich selbst.« — »Siehst du«, sagt der Rabbi, »wenn du dein Leben lässt, wie es ist, so siehst du wie durch Glas auf die ganze Welt bis zu ihrem Schöpfer. Ist dir aber das Glas nicht genug und legst du nur ein bisschen Silber auf, dann siehst du nur dich selbst.« Wer glaubt, blickt durch. Wer betet, bleibt nicht vor dem Spiegel stehen — bei sich und seinem Aussehen. Er sieht weiter, über sich selbst hin- aus. Er weitet seinen Horizont. Wir sind nicht die Techniker und Macher unseres Daseins. Das Leben ist voller Überraschungen, einfach spannend. Es geht weit über das hinaus, was wir planen und ins Werk setzen. Wir leben nicht nur vom Markt und vom Geschäft. Wir leben von Ver- trauen, von Hoffnung und Liebe, kurzum von dem, was nicht zu machen und zu kaufen ist. Das verändert uns — und die Welt. Wenn aber die Liebe Realität ist und Realitäten schafft, sollte dann der Dialog mit dem Ursprung der Liebe ohne Wirkung sein? Das kann doch nicht wahr sein! Christen glauben: Am Anfang von allem steht nicht etwa nur der Urknall oder irgendetwas, sondern er, Gott in Person, schöpferische Liebe. Und der Dialog mit diesem Ursprung unseres Daseins ist die Achse, um die sich alles dreht. Das heißt beten. Es ersetzt nicht das eigene Tun. Aber ebenso wenig ersetzt unser Tun das Beten."
(aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke, Jahreslesebuch, hrsg. von Ulrich Schütz, Freiburg 2014, S. 231.)
Franz Kamphaus, geb. 1932, war von 1982 bis 2007 katholischer Bischof von Limburg. In diesem Sommer gehören seine Betrachtungen zu meiner Urlaubslektüre.
Peter Kanehls
04.07.2021
Ich habe einen Traum
Aus der Traum! Die deutsche Nationalelf ist im Achtelfinale gescheitert. Kein Sommermärchen 2021. Die Fans treten enttäuscht die Rückreise an. Ernüchterung legt sich auf die Fußballgemeinde. Träume sind Schäume, sagen entmutigt die einen. Lebe deinen Traum, begeistern sich die anderen. Wer aufhört zu träumen, hört auf, zu leben, sagt ein Sprichwort. Martin Luther King hat für seinen Traum mit dem Leben bezahlt. 1968 wurde er in Memphis, Tennessee von einem Attentäter ermordet. „I have a dream“, hatte er 1963 in seiner legendären Rede in Washington 250.000 Zuhörern zugerufen und von seinem Traum einer besseren Welt erzählt. Seltsam, dass die Vision von Gerechtigkeit und Frieden damals wie heute für manche Menschen bedrohlich wirkt und Widerspruch hervorruft, oder? Vielleicht, weil dieser Traum eben nicht nur ein Traum ist, sondern einen echten Anhaltspunkt in einer wirklichen Person hat? Denn in Jesus Christus ist Gott selbst zur Welt gekommen und hat sich uns menschlich gezeigt. Er hat seinen Traum von einer versöhnten Menschheit nicht nur geschildert, er hat ihn gelebt. Viele sind ihm darin bis heute gefolgt und haben Großes bewirkt. Wovon träumst Du? Wie wäre es, den Traum Gottes in Deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen? „Ein Beispiel habe ich euch gegeben“, sagt Jesus, „damit ihr tut, wie ich euch getan habe (Joh 13,15). Es ist eigentlich ganz einfach. Mach Dich mit Jesus vertraut, nimm ihn beim Wort, gib ihm Raum in deinem Herzen, und dann lebe Deinen Traum!
Peter Kanehls
27.06.2021
Wohin sonst sollten wir gehen
Niemandes Weg ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Enttäuschungen gehören zu unserm Leben dazu. Seltsam, dass sie so negativ besetzt sind, denn wenn ich enttäuscht werde, heißt das doch, dass ich vorher getäuscht war, oder? Und wenn nun die Täuschung offenbar geworden und aufgehoben ist, ist das doch eigentlich gut. Eine Wortspielerei, gewiss, doch nicht ganz ohne Wahrheitsgehalt. Enttäuschungen betreffen zumeist Menschen. Zwar hält manchmal eine Anschaffung nicht, was sie verspricht, doch Enttäuschungen durch andere Menschen sind meist schwer zu ertragen. Da ging es den Jüngern Jesu nicht besser. Nachdem sie nun schon eine Zeit mit Jesus unterwegs waren, wuchsen die Irritationen, die Schwierigkeiten miteinander – von den bedrückenden Lebensumständen und der Verfolgung durch die Feinde Jesu ganz zu schweigen. Wie soll man damit umgehen? Ist es nicht so: Vorkommnisse, die wir anderen nachtragen, die tragen wir(!) immer noch selber. Sie Kosten unsere Kraft und treiben uns um, halten uns besetzt und bedrücken Herz und Gemüt. Nachtragen – das ist eine ganz schlechte Lösung. So werden wir Enttäuschungen nicht los. Tatsächlich haben sich viele Jünger Jesu nach einiger Zeit von ihm abgewandt. Das Neue Testament erzählt davon: „Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist des lebendigen Gottes Sohn.“ Nicht, dass Petrus nicht auch so seine Bedenken hat, was Jesus angeht. Nur dass er sie nicht mit sich allein abmacht, sondern das Gespräch sucht. Und dass es sich auf das besinnt, was er bei Jesus von Gott erfahren und erlebt hat. Kann es sein, dass wir oft und viel zu schnell aufgeben, abtauchen, Schluss machen, uns selbst bemitleiden, nicht danach fragen, was sich Gott vielleicht dabei für uns gedacht hat? Könnte es sein, dass wir die Worte ewigen Lebens, die für uns in der Bibel aufgeschrieben sind, schon lange nicht mehr gehört haben? Könnte es sein, dass wir uns selbst in die Enttäuschung hineinmanövrieren, wenn wir, statt auf Gott zu hören, ihm unser Bild von ihm vorhalten, von dem wir dann ja tatsächlich nur enttäuscht sein können? Was also tun, wenn wir nicht weiterwissen? Was, wenn wir uns festgefahren haben, wenn wir feststecken in unserem Leben? Glauben wir doch und vertrauen darauf, dass Gott es nicht böse mit uns meint. Erinnern wir uns an all das Gute, das wir von ihm empfangen haben. Und dann besinnen wir uns, wie Petrus, auf die Worte, die uns haben leben lassen, uns froh gemacht und uns geholfen haben – Worte Jesu, gelesen, gehört, gesungen, geglaubt – Erfahrungen mit Gott mitten im Alltag. Thea Eichholz-Müller hat das auf dem Hintergrund eigener schwerer und enttäuschender Erfahrungen so zusammengefasst: „Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du, du führst uns zum Leben zurück, nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt, an deiner Hand kann ich fallen, und du hältst mich fest, an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.“ Es ist dies die in Schwerem und aus Enttäuschungen heraus gewonnene Erkenntnis, dass nichts und niemand uns von Gott trennen kann, wenn wir es nicht zulassen. Nur bei ihm sind wir letztlich in guten Händen. Wohin sonst sollten wir gehen?
Peter Kanehls
20.06.2021
Der Himmel geht über allen auf
Am 20. Juni feiern wir in Dänischenhagen zusammen mit den Gemeinden Gettorf, Krusendorf und Osdorf den ersten Sonntag unserer Sommerkirche 2021. Dieses Jahr haben wir unsere Gottesdienste unter die Überschrift „Himmel, Erde, Luft und Meer“ gestellt. Das sind die ersten Worte eines Liedes, und die Idee ist, dass in jedem der vier Gottesdienste der Sommerkirche jeweils ein Stichwort das Thema für das gemeinsame Singen und Beten und für die Predigt angibt. In Dänischenhagen beschäftigt uns also der Himmel, und was er mit uns zu tun hat. Wem das weltfremd vorkommt, der bedenke, was Jesus gesagt hat, als er einmal gefragt wurde, wann das Reich Gottes, von dem die Propheten gesprochen haben, das Königreich der Himmel, denn nun endlich erfahrbar, spürbar, Wirklichkeit wird. Jesus antwortet: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. (Lk 17,21) Will sagen: In Jesus hat Gott begonnen, seine neue Welt, den Himmel auf Erden, seine Königsherrschaft zu verwirklichen. Und alle sollen daran Anteil haben, die sich auf Jesus einlassen, ihm nachfolgen und mit ihm leben. Die Erde wird wohl nie zum Himmel werden, jedoch gibt es manchmal Erlebnisse, die unseren irdischen Alltag unvermutet durchbrechen und wie ein Hinweis auf den Himmel unter uns sein können.
Gerd-Matthias Hoeffchen schreibt unter der Überschrift „Die Schönheit des Himmels“: Manchmal kann Schönheit richtig wehtun. Mir ist das vor nicht allzu langer Zeit passiert. Es war auf dem Rückflug von einer Auslandsreise. Ich hatte mich mit meinen Sitznachbarn angeregt unterhalten. Jetzt war es spät in der Nacht, und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Draußen warf der Mond sein Licht auf die Wolken unter uns, über uns schien der Himmel sich Mühe zu geben, das Klischee von der sternklaren Nacht und den erhabenen Momenten erfüllen zu wollen. Ich stellte mir die Wolken als Gebirge vor, zwischen dessen Gipfeln man auf dem Rücken eines Fabelwesens sitzend hindurchgleiten würde. Oder lieber gleich selbst fliegen können? Alles andere da unten, die Erde, die Menschen, die Sorgen, es wäre so weit weg. Plötzlich brach die Wolkendecke auf. Sie gab den Blick frei auf ein Meer von Lichtern. Trauben von funkelnden, glitzernden Leuchtpunkten, ein kristallener Glanz in der Schwärze der Nacht, als hätte sich der Sternenhimmel auf die Erde gestürzt — die Lichter des Ruhrgebiets, dem wir uns von Norden her näherten. Ich kann im Nachhinein nicht mehr genau sagen, was ich gefühlt habe, dort über den Wolken. Es muss eine Art ungläubigen Erstaunens gewesen sein, eine vollständige Überraschung. Zeit hörte auf, Denken hörte auf. Ein Druck war da, eine Spannung. Ein irrsinniges Glücksgefühl und gleichzeitig tiefe Schwermut. Da war ein Schmerz, so groß wie das Universum. Und ein Trost, der alles umfing. War das — die Seligkeit? Die Wolkendecke schloss sich, ich wischte mir die Tränen vom Gesicht. Eine dreiviertel Stunde später stand ich schon wieder auf dem Bahnsteig, musste mich mit verspäteten Anschlusszügen und mürrischen Taxifahrern befassen. Aber das Gefühl, für einen Moment einen winzigen Augenblick in die Ewigkeit erhascht zu haben, blieb. Was immer das da oben auch gewesen sein mochte: Wenn es schon jetzt, in diesem Leben möglich war, solche Schönheit zu empfinden, was für eine Glückseligkeit mag uns erwarten, wenn der Himmel einmal seine ganze Pracht preisgeben wird?
(von Gerd-Matthias Hoeffchen, in: Die getanzte Kollekte, Hg. Bernd Becker, Bielefeld 2019, S. 176f.)
Im letzten Buch der Bibel beschreibt Johannes, wie er einen Blick in die Zukunft tun und sehen durfte, wie Himmel und Erde zusammenfinden und versöhnt werden. Er schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!
(Off 21,1-5)
Peter Kanehls
13.06.2021
Kurz gesagt
Herrlich, was ich neulich las: »Die Zehn Gebote haben 279 Wörter. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter. Die EU-Verordnung zur Einfuhr von Karamellbonbons 25911 Wörter.« Natürlich stimmt's nicht. Die EU-Verordnung existiert nicht, bei der Unabhängigkeitserklärung wurde gemogelt (ist viel länger). Trotzdem habe ich gelacht — die Tendenz stimmt ja. Warum machen wir so vieles im Leben lang und kompliziert? Das Vaterunser hat 63 Wörter (können Sie nachzählen). Die Kirchliche Dogmatik, mit der der Theologe Karl Barth Generationen von Pfarrerinnen und Pfarrern geprägt hat, 9000 Seiten. Ein bisschen haben wir wohl verlernt, die wirklich wichtigen Dinge kurz und knapp zu sagen. Sicher, manches ist kompliziert. Die Sicherheitsbestimmun- gen für ein Atomkraftwerk lassen sich nicht auf einem Spickzettel zusammenfassen. Da geht es um Genauigkeit, Absicherung. Um Eventualitäten. Und selbst simple Wahrheiten müssen oft ausgelegt und erklärt werden. Schauen Sie sich mal juristische Fachliteratur an. Oder die Packungsbeilage Ihrer Medizin. Und trotzdem wäre es schön, wenn wir die Wahrheiten hinter den Erklärungen nicht aus dem Blick verlieren würden. Denn die wirklich wichtigen Dinge lassen sich kurz und bündig sagen. Ich liebe dich. Euch ist heute der Heiland geboren. Deine Schuld ist dir vergeben. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind Wahrheiten, die verlieren, wenn man sie aufbläht. Wie meine Wahrheit aussieht? Ich versuche es mal: Gott liebt dich. Er ist für dich da. Er verspricht dir nicht, dass dein Weg immer unbeschwert, hell und voller Freude sein wird. Aber er gibt dir die Kraft, diesen Weg unter allen Umständen zu gehen. Bis zum Ziel. Und dort wartet er auf dich.
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4,21
Gerd-Matthias Hoeffchen
(aus Bernd Becker (Hg.), Die getanzte Kollekte, S. 148f., Bielefeldt 2019)
06.06.2021
Alle werden gebraucht
Die Werkzeuge des Tischlers waren zu einer Besprechung zusammengekommen. Der Hammer wurde zum Leiter gewählt. Doch schon bald musste er von den anderen Werkzeugen hören, dass er sein Amt niederlegen solle, da er zu grob und lärmend sei. Mit gekränkter Miene bemerkte der Hammer: „Dann muss auch der Hobel gehen. Seine Tätigkeit ist immer so oberflächlich!“ „Schön", sprach der Hobel, „dann wird auch der Bohrer gehen müssen. Er ist als Persönlichkeit so uninteressant und leistet niemals aufbauende Arbeit!“ Der Bohrer meinte beleidigt: „Gut, ich gehe, aber die Schraube auch. Man muss sie immer drehen und drehen, bis man mit ihr zum Ziele kommt!“ „Wenn ihr wollt, gehe ich“, sprach die Schraube gekränkt, „aber der Zollstock ist doch viel ärgerlicher. Er will über alles urteilen, und alle müssen sich nach ihm richten!“ Der Zollstock klagte daraufhin über das Schmirgelpapier. „Solche rauhen Manieren wollen wir nicht, und immer die Reibereien mit anderen Leuten gefallen uns nicht!“ Während sich die Werkzeuge beklagten und übereinander entrüsteten, trat der Tischler in die Werkstatt, band sich die Schürze um und fing an, mit all den Werkzeugen zu arbeiten. Er schuf eine wunderbare Kanzel, von der aus den Menschen das Evangelium gepredigt werden sollte.
Eine Geschichte aus England, die für sich selbst stehen kann. Ich will sie aber ergänzen durch ein Wort aus dem Neuen Testament. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus heißt es: Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens! (Epheser 4,2f) Tatsächlich kann einem die Verschiedenartigkeit der Menschen etwa in einer Gemeinde, in einer Firma oder auch in der Verwandtschaft einige Mühe verursachen. Das Bild vom Werkzeug, das in der Hand des Tischlers auf je unterschiedliche Weise benutzt dazu beiträgt, etwas Schönes und Sinnvolles zu schaffen – dieses Bild kann uns daran erinnern, dass jeder Mensch auf seine je besondere Weise mit seinen je besonderen Gaben und Fähigkeiten zu etwas zu gebrauchen ist. Vielleicht, dass das nicht immer offensichtlich ist; vielleicht, dass der Blick auf die eigenen Vorlieben und Schwierigkeiten das Verständnis füreinander erschwert. Ich empfehle deshalb, eine Schraube oder ein Stückchen Schmirgelpapier bei sich zu tragen, um sich im alltäglichen Getümmel an das Bild vom Werkzeug erinnern zu lassen. Machen wir uns klar: Erst in der Ergänzung, im Miteinander und Füreinander kann etwas entstehen, das uns hilft, zu leben, und das über unseren begrenzten Horizont hinausweist. Wir sollen einander in Liebe ertragen – nicht zähneknirschend und mit halbem Herzen, sondern in dem Bewusstsein, dass die Liebe Gottes nicht nur uns, sondern auch den anderen gilt. Gemeinsam sind wir die „Werkstatt“, die dazu beitragen kann, die Gute Nachricht von der Liebe Gottes Gestalt werden zu lassen. Ob nun Hammer oder Hobel, alle werden gebraucht.
Peter Kanehls (nach einer Idee von Axel Kühner)
30.05.2021
Ein Gebet
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr,
sondern um Kraft für den Alltag!
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte:
Mache mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei und Allerlei
rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren,
von denen ich betroffen bin.
Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung,
schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden,
was erstrangig und was zweitrangig ist.
Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen,
weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun
und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen.
Bewahre mich vor dem naiven Glauben,
es müsste im Leben alles glattgehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,
durch die wir wachsen und reifen!
Erinnere mich daran,
dass das Herz oft gegen den Verstand streikt.
Schick mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat,
mir die Wahrheit zu sagen!
Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen.
Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst,
sie wird einem gesagt.
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.
Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten,
riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen bin!
Verleihe mir die nötige Phantasie,
im rechten Augenblick ein Päckchen Güte
mit oder ohne Worte an der richtigen Stelle abzugeben.
Mach aus mir einen Menschen,
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht,
um auch die zu erreichen, die „unten" sind.
Bewahre mich vor der Angst,
ich könnte das Leben versäumen.
Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern was ich brauche.
Antoine de Saint-Exupéry
23.05.2021
Von GOTT beGEISTert
Das Pfingstwunder, von dem die Bibel erzählt, besteht darin, dass die Männer und Frauen, die Jesus gefolgt sind, eines Tages in Jerusalem auf die Straße hinaus gehen und begeistert von Gottes großer Liebe erzählen. Das Besondere daran: Die Menschen auf der Straße kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern und sprechen folglich auch ganz unterschiedliche Sprachen. Dennoch verstehen sie, was die Jünger Jesu sagen. Pfingsten, so scheint es, wird die große Sprachverwirrung, die beim Turmbau zu Babel entstanden ist, in ihr Gegenteil verkehrt und geheilt. Pfingsten schauen wir über den Tellerrand unserer Institutionen, unserer Überzeugungen und unserer Vorurteile. Nachdem ich meine Predigtvorbereitungen für den Pfingstsonntag schon abgeschlossen habe, blättere ich eben noch in einem Buch von Franz Kamphaus, der bis 2007 katholischer Bischof von Limburg war, und bin überrascht und erfreut, bei ihm etwas zum Turmbau von Babel zu finden – eben jener biblischen Geschichte, die meiner Pfingstpredigt zugrunde liegt. Er schreibt unter der Überschrift „Aus Babylon heraus“:
„Turmbau zu Babel — die alte Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel ist so aktuell wie eh und je: Menschen wollen den Himmel stürmen und fallen schließlich aus allen Wolken. Sie starten zum Höhenflug und zerschellen am Boden. Muss das so weitergehen? Gibt es keine Alternative? Keinen Weg, der herausführt aus der Geschichte Babylons, aus der Geschichte der Selbstzerstörung der Menschheit?
Pfingsten ist der Anfang eines neuen Weges, heraus aus Babylon. Verschlossene Fenster und Türen werden aufgestoßen. Menschen finden sich zusammen, die nicht von der Erde weg nach den Sternen greifen, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und empfangen, was nicht zu machen ist: Das »Geschenk des Himmels«, Gottes heiligen Geist.
Da gerät etwas in Bewegung, man kann es erfahren. Die Begeisterten beginnen zu reden, und — wie ein Wunder — sie verstehen sich untereinander und werden verstanden. Sie finden sich nicht ab mit dem, was ist, mit dem Ist-Stand der Welt. Sie sagen nicht: »Die Welt ist nicht mehr zu retten, drum rette sich, wer kann ...« Sie sagen: »Es gibt ganz ungeahnte Möglichkeiten, die Möglichkeiten Gottes mit uns.« Sie fangen Feuer und brennen darauf, diese Möglichkeiten zu verwirklichen: »Worauf Gott seine Hoffnung setzt, das wagen wir ...« Menschen mit einer Leidenschaft für das Mögliche! Menschen, deren Erwartungen nicht mit den selbstgemachten Türmen stehen und fallen, die mehr erwarten als sich selbst, die tatsächlich Gott erwarten.
Zwischen Babylon und Pfingsten. Jeder von uns hat seine Erfahrung mit diesem Weg. Wohin gehen wir, in welche Richtung? - Gott hat die Initiative ergriffen, Pfingsten ist seine Initiative, eine Art Bürgerinitiative, die er ins Leben gerufen hat. Gerufen sind Bürgerinnen und Bürger einer neuen Welt, die Babylon den Rücken kehren und im Vertrauen auf die Kraft des Geistes Gottes das Mögliche tun.“ (Franz Kamphaus, Lichtblicke, Jahreslesebuch, hrsg. Ulrich Schütz, Freiburg im Breisgau 2014, Seite 157)
Ja, tatsächlich sind wir seit Pfingsten nicht mehr ohne Gott. Er ist zu uns gekommen und möchte uns begleiten. Mehr noch: Gott wünscht sich, bei uns – und sogar in uns – zu bleiben, damit wir „im Vertrauen auf die Kraft des Geistes Gottes das Möglich zu tun.“ Was aber möglich ist, und was nicht, das entscheidet sich letztlich bei Gott. Unser Part ist das Vertrauen auf ihn, sein Wort und seine Möglichkeiten. So bete ich in diesen Tagen mit Worten eines Liedes, das wir in unsere Gemeinde nicht nur zu Pfingsten singen: „Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.“
Ich wünsche uns in dieser Zeit um Pfingsten herum neue Erfahrungen mit der uns verbindenden und Leben schaffenden Kraft Gottes.
Peter Kanehls
16.05.2021
„Top Five“ oder was wollen wir singen?
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung. „Alles fließt“, sagten schon die alten Griechen, und Martin Luther hat das Wort von der sich beständig erneuernden Kirche geprägt. Wo Bewegung ist, da ist Leben. Eine Lebendige Kirche bewegt, wandelt und verändert sich manchmal überraschend, so wie im Fall der neuen Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) – sie heißt Anna-Nicole Heinrich, ist 25 Jahre alt und studiert Philosophie. Doch nicht nur auf Leitungsebene, sondern auch an der Basis sind wir eingeladen, am Aufbau und der Erneuerung der lebendigen Kirche mitzuwirken. Das 1994 in der Nordelbischen Kirche eingeführte Gesangbuch ist in die Jahre gekommen und soll bis 2030 gründlich überarbeitet werden. Dafür braucht es Vorschläge. Was wollen wir singen in Kirche und Gemeinde? Welche Lieder haben sich bewährt? Die sollen bleiben. Welche konnten sich nicht durchsetzen? Die sollen aussortiert werden. Die Arbeitsgruppe der EKD verspricht, sich mit allen Vorschlägen zu befassen. Auf der Internetseite www.ekd.de/top5 finden Sie Infos, wie Sie sich beteiligen und Vorschläge einreichen können. Ich finde diese Initiative bemerkenswert in einer Zeit, da wir seit Monaten in der Kirche nicht singen dürfen. Viele Menschen erleben das als bedrückend. Es ist befremdlich, dem Gottesdienst stumm folgen zu müssen, statt von Herzen einstimmen zu können oder sich mitnehmen zu lassen vom Gesang der Gemeinde. Immerhin darf neuerdings draußen(!) unter der Maske gesungen werden, und deshalb werden wir unsere Gottesdienste sobald, als möglich, wieder vor(!) die Kirche verlegen. Wir haben damit im vergangenen Sommer gute Erfahrungen gemacht. Das Singen draußen tat gut. Die Gesangbuchinitiative der EKD macht Mut und zeigt uns, dass noch nicht „aller Tage Abend“ ist. Es gibt Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, da wir loben und danken und wieder singen werden, ohne dass uns Masken und Modalitäten Mühe machen. Unser Gemeindeleben hat schon jetzt wieder Fahrt aufgenommen, die Veränderungen einer digitalisierten Welt haben in uns vieles möglich gemacht, und dass wir uns online treffen können, es sei im Jugendkreis oder im Kirchengemeinderat, ist hilfreich und gut. Ich freue mich aber schon darauf, dass wir uns bald auch wieder analog treffen werden, eine unverzichtbare Form der Gemeinschaft, die uns helfen kann, unsere Mitte nicht zu verlieren – das ist der lebendige Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, und der in allen Veränderungen an unserer Seite ist.
Peter Kanehls
09.05.2021
Gretchenfrage
Die Gretchenfrage kommt mir in den Sinn. Das junge Gretchen, also Margarethe, fragt den älteren Dr. Faustus, der ihr schmeichelt und um sie wirbt: „Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub’, du hältst nicht viel davon.“ Faust weicht aus, wiegelt ab, lässt sich nicht festlegen. Gretchenfragen sind unangenehm, denn sie fordern uns heraus, Stellung zu beziehen und erwischen uns dabei nicht selten an einem schwachen Punkt. Statt ein klares Bekenntnis abzulegen, verlieren wir uns in rechtfertigendem und entschuldigendem Gerede. Das haben wir wohl alle schon einmal erlebt. Die neue Woche, die mit dem Sonntag Rogate beginnt, fragt uns – nun nicht nach unserem Verhältnis zur Religion, sondern nach unserm Beten. Sag, wie hast du´s mit dem Gebet, so könnte meine Gretchenfrage lauten. Von Berufs wegen habe ich viel mit Gebet zu tun. Aber wäre meine Beziehung zu Gott nur eine berufliche, ich wäre arm dran. „Beten ist Reden mit Gott und Hören“, heißt es in einem Lied, und ich finde, das ist treffend ausgedrückt. Beten ist der Schlüssel zu Gott, ganz gleich, wie ich ihn mir vorstelle. Dass ich mich ihm zuwende, ihm meine Gedanken sage, meine Freuden und Sorgen mitteile, das bringt mich ihm näher. Dass ich still werde und vor ihm und mit ihm mein Leben bedenke, meinen Tag reflektiere und für die Menschen um mich her danke, und für die, die zu mir gehören, seinen Segen erbitte, das bewirkt in mir eine neue Sicht. Menschen erscheinen liebenswert, Begebenheiten ergeben einen Sinn, Erfahrungen bringen mich voran – nicht immer sofort, aber doch mit der Zeit. Und dies alles hat mit Gott und meinem Gebet zu tun. „Nun sag, wie hast Du´s mit dem Gebet?“ Ich fürchte, es sind recht viele Missverständnisse über das Beten im Umlauf. Sprechen wir nicht mit denen, die zu uns gehören? Reden wir nicht mit denen, die uns vertraut sind? Sprechen wir nicht so, „wie uns der Schnabel gewachsen ist“, und teilen wir ihnen nicht mit, was uns am Herzen liegt? Wo ich nichts erwarte, wird sich auch nichts entwickeln. Gott aber wohnt nicht in der Kirche oder im Himmel oder in irgendwelchen tiefgläubigen Menschen – das heißt: doch, er wohnt auch dort, aber vor allem lebt Gott mitten unter uns und ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Nicht selten handelt Gott an uns auf unspektakuläre Weise. Da kommt kein Blitz vom Himmel, es gibt keinen Posaunenschall, die Erde bebt nicht, keine Engelsgestalten erscheinen – oder was man sonst so mit Gottes Eingreifen in Verbindung bringen würde. Nein, nicht selten ergeht es uns wie diesem Mann, der seinen Freunden von seinen Urlaubsabenteuern erzählte. Er hatte sich auf einer Wüstentour verlaufen und war tagelang in der Einöde von Sand und Sonne umhergeirrt. Eindrucksvoll schilderte er seine Ängste und Verzweiflung. Schließlich sei er in seiner Todesnot niedergekniet und habe Gott um seine Hilfe angefleht. Stunden habe er gebetet und zu Gott gerufen. Aber ehe Gott eingreifen und helfen konnte, meinte er, sei ein Forschungsteam vorbeigekommen und habe ihn glücklich in sein Quartier gebracht. Eine schlimme Situation, die ein gutes Ende genommen hat. Sie hat nichts mit Gott zu tun? Wirklich nicht? Kann es sein, dass auch wir auf diesem Auge oft genug blind sind? Wäre das nicht eine Möglichkeit, den, der nur ein Gebet weit von uns entfernt ist zu bitten, uns die Augen zu öffnen für das, was er in unserem Leben getan hat und noch tut. Es käme auf den Versuch an.
Peter Kanehls
02.05.2021
Loben zieht nach oben...
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder.“ Ein Sprichwort aus einer Zeit, da man sich spontan zusammenfand, um zu singen – nach Feierabend auf der Bank vor dem Haus, oder im Dorfkrug, im Familienkreis, oder was es sonst für Anlässe und Gelegenheiten gab – sich zusammenzusetzen, durchzuatmen und einzustimmen in Lieder, die allen gemeinsam waren. Volkslieder, man mag von ihnen halten, was man will, geben uns noch immer einen Eindruck von einer Kultur des gemeinsamen Singens, die nicht als ein Event daher kommt. Ohne Eintritt zahlen zu müssen, kommen Freunde, Nachbarn, Kollegen zusammen und vertreiben sich die Zeit aus „Spaß an der Freud“. Das alles scheint lange vorbei zu sein. Heute singen die Profis und legen die Latte hoch. Da traut man sich als Laie kaum noch etwas zu. Wo wird heute noch gesungen? Ich denke nicht an Chöre – weder Schul- noch Kirchenchöre – nein, ich denke an den Gottesdienst in unseren Kirchen. Mag sein, durch Corona gibt es gerade auch für den Gesang der Gemeinde strenge Auflagen. Singen ist momentan nur unter freiem Himmel und unter der Maske erlaubt. Aber wir werden Corona überwinden, und dann wird der Gemeindegesang wieder kraftvoll und zuversichtlich erklingen. Es gibt dafür nicht nur das Gesangbuch, sondern eine riesengroße Vielfalt an alten und neuen Liedern in Kirche und Gemeinde, die nicht nur mit der Orgel begleitet, sondern zu den unterschiedlichsten Instrumenten gesungen werden können – vielleicht nicht an jedem Sonntag, aber doch immer wieder. Wer will, kann auch ohne in einen Chor oder Gesangverein zu gehen, jede Woche die Stimme erheben und gemeinsam mit anderen die Erfahrung machen, dass Singen guttut. Am 2. Mai feiern wir in diesem Jahr den Sonntag Kantate, so der alte Name. Kantate heißt „Singt!“, und mir scheint, dass es tatsächlich dieser Aufforderung bedarf, denn das Singen kann uns schon vergehen, wenn wir die Nachrichten aus aller Welt hören, und wie schlimm es um die Menschen in manchen Gegenden bestellt ist. Lassen wir uns doch nicht Bange machen. Wir können das eine tun, ohne das andere zu lassen – können uns engagieren in den mancherlei Herausforderungen dieser Welt, und können zugleich dafür sorgen, nicht im Strudel dunkler Gedanken und Gefühle zu versinken. Singen ist da eine gute Möglichkeit. Mir persönlich gefallen ja die Lieder gut, die mich daran erinnern, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält und wir bei IHM in guten Händen sind. Lieder, die von Gott erzählen, sie machen Mut und können trösten, sie helfen mir zu beten und reißen mich heraus aus dem Kreisen um mich selbst. Das ist wohltuend und wegweisend. Zuletzt: Wer singt, atmet tiefer durch und tut damit etwas für seine Gesundheit. Gerade auch die Lieder, die von Gott erzählen, bewirken in mir manche Veränderung, und ich sehe mich, die Menschen um mich her, meinen Weg und meine Ziele mit anderen Augen. Auch das tut gut, gelegentlich in eine kritische Distanz zu sich selbst zu gehen, sich hinterfragen zu lassen oder bestätig zu werden. Viele Lieder in Kirche und Gemeinde bieten dazu Gelegenheit. Gemeinsam zu singen und darüber zu reden, hilft also sogar zum Glauben. Ich lade herzlich dazu ein. Mag sein, es braucht ein bisschen Übung, wenn man lange so gar nicht gesungen hat und auch keine Lieder mehr kennt. Aber das findet sich mit der Zeit, und wir machen uns damit selbst vielleicht das größte Geschenk. Ein anderes Sprichwort sagt nämlich: „Loben zieht nach oben, und Danken schützt vor Wanken.“ Wer immer nur kritisiert und fordert, der wird am Ende unglücklich. Lob aber und Dank wecken positive Kräfte in uns und anderen. Gott zu loben und ihm zu danken gelingt am Besten mit einem Lied im Herzen oder auf den Lippen, nicht nur in Kirche und Gemeinde. Darum will ich mir das Motto dieses Sonntags wieder neu zu eigen machen und singen „was das Zeug hält“ – singen gegen die Krise, gegenansingen und glauben und hoffen, loben und danken. Grund dazu gibt es immer. Schauen wir nur genau hin.
Peter Kanehls
25.04.2021
Eine Art Klimawandel
Meine Urlaubslektüre in Corona-Zeiten. Tomas Sjödin, Pastor im schwedischen Göteborg hat im vergangene Jahr eine Auswahl von Kolumnen veröffentlicht, die er in den letzten Jahren für eine große Göteburger Zeitung geschrieben hat – kurze überschaubare Texte, wie geschaffen für einen Gedankenanstoß am Frühstückstisch, zum Start in den Tag oder zum gegenseitigen Vorlesen. Ich möchte eine Kostprobe daraus geben. Wer sich das Buch zulegen möchte, hier der Titel: Tomas Sjödin, Beginne jeden Tag wie ein neues Leben, Von der Gewissheit, dass es hell wird, Holzgerlingen 2020.
Unter der Überschrift „Hat jemand irgendwas richtig gemacht?“ schreibt Tomas Sjödin:
„Wie gut es ist, mit einem guten Gewissen aufzuwachen, wird allgemein unterschätzt“, pflegt mein norwegischer Freund Per Arne zu sagen. Das ist wahr und klug, und doch ist das schlechte Gewissen nur schwer auf Abstand zu halten. Es gehört nun mal nicht zur menschlichen Natur, fehlerfrei, vorurteilsfrei und schuldenfrei zu sein. und deshalb fühlt man sich manchmal schuldig. Egal ob es dafür einen guten Grund gibt oder ob man sich die Schuld anderer auflädt. Ich meine jedenfalls, dass das in unserer Gesellschaft vorherrschende Klima empfindliche Gewissen belastet. Der öffentliche Fokus ist stets auf Fehler und Unregelmäßigkeiten gerichtet. und deshalb Überlege ich mir genau, wie viele Nachrichten ich mir antue, vor allem am Morgen. Ich glaube, dass ich nicht alles über alle wissen muss, die lügen, betrügen und auf Kosten anderer leben. Es ist schlimm genug, dass es so ist. Und es ist natürlich wichtig, dass Menschen, die Macht haben und unser Vertrauen genießen sollten, kritisch beäugt und genau unter die Lupe genommen werden. Aber die Frage, ob irgendjemand irgendetwas falsch gemacht hat, steht meiner Meinung nach zu weit oben auf unserer Tagesordnung. Wonach wir suchen und worauf wir uns konzentrieren, das schafft ein bestimmtes Klima. Eine ständig nach Fehlern suchende Gesellschaft macht uns leicht nervös — obwohl es meistens keinen Grund dafür gibt. Der erste Gedanke, wenn wir in der Post einen Brief vom Finanzamt finden, heißt: Was habe ich falsch gemacht? und: Das wird teuer. Dabei liegt man meistens daneben. In der eigenen Familie ist es nicht anders. Wo sich allzu viel Interesse auf Unzulänglichkeiten, Fehler und Schludrigkeit richtet, entsteht genau diese nervöse Stimmung. Man hat solch eine Angst, etwas Falsches zu tun, dass man zu blockiert ist, um das Richtige zu tun und daran Freude zu haben. Es gibt eine wichtigere Frage, auf die man seine Aufmerksamkeit richten könnte: Hat irgendjemand etwas richtig gemacht? Zu sehen, was gut gelaufen ist, bewusst wahrzunehmen und manchmal zu feiern, was gelungen ist und was ein wichtiger Beitrag war, das schafft auch ein Klima. Ein wärmeres und kreativeres Klima. Mehr über das zu sprechen, was gut läuft, als über das, was nicht funktioniert hat, scheint manchem „irgendwie süßlich“ zu sein, so als hätte es weniger mit der Realität zu tun als die Fehlersuche. Dabei ist die Wirklichkeit eine facettenreiche Angelegenheit, die zu Teilen durch das geschaffen wird, was wir übereinander denken und wie wir uns begegnen. Ich glaube deshalb, dass es unsere Gesellschaft aufbaut und voranbringt, wenn wir uns jeden Tag darin üben, das Gute aktiv und aufmerksam zu suchen. Im Philipperbrief, der einen fröhlichen Ton anschlägt, werden wir dazu aufgefordert, an dem festzuhalten, was als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient (Philipper 4,8). „Richtet eure Gedanken darauf“, heißt es zu Beginn dieses Verses. Ich glaube mehr und mehr an die Kraft, die in dieser bewussten Ausrichtung unserer Sinne liegt. Das hat zwei Gründe: Zum einen genügt keiner von uns den Anforderungen, alle reißen manchmal die Latte. Zum anderen schafft die Suche nach dem Guten ein Klima, in dem es leichter ist, Schlechtes und Fehltritte zu vermeiden. Und dieser Klimawandel macht allen Freude.
(aus: Tomas Sjödin, Beginne jeden Tag wie ein neues Leben, Von der Gewissheit, dass es hell wird, Holzgerlingen 2020, S. 107-109.)
Peter Kanehls
18.04.2021
"von oben betrachtet..."
Dieser Tage ruft mich ein Freund an, und wir erzählten einander aus unserm Alltag und wie wir so zurecht kommen unter den Bedingungen, die uns die Pandemie aufdrückt. Es gibt für ihn solche und solche Tage, meint er – Tage voller Zuversicht und Tage voll Verunsicherung und Sorge. Das schwankt so hin und her, und man kommt sich vor wie auf hoher See, ohne festen Boden unter den Füßen, und kein Land in Sicht. Wir bedauern einander rechtschaffen, sind uns dann aber einig, dass wir nicht in Hoffnungslosigkeit versinken wollen. Ohne uns die Lage schön zu reden, suchen wir nach einem Gedanken oder einem Bild, das uns Hilfestellung gibt und Orientierung schenkt, ermutigt und tröstet. Er müsse an seine Großeltern denken, sagt er. Bei seinen Großeltern in der guten Stube lag noch einer dieser gewebten, dicken, bunten Teppiche. Zum Frühjahrsputz wurde das kostbare Stück in den Hof getragen und über die Teppichstange gehängt. Da zeigte er seine Kehrseite: Wirr liefen die Fäden durcheinander, kreuz und quer baumelten die Enden, scheinbar ohne Sinn vermischten sich die Farben und ließen nicht einmal die Muster ahnen. Aus unserer Sicht. Doch von oben waren die feinen Muster zu erkennen, die Klarheit der Linien, die Reinheit der Farben, das sinnvoll und schön Geordnete. So, sagt er, gehe es ihm manchmal im Leben: Er sehe nur die Unterseite, die ungeordnete Seite seines Lebens, kann den Sinn nicht verstehen, weiß nicht das Ziel, ist verwirrt und verunsichert. Aus Gottes Sicht jedoch füge sich ein Muster an das andere zum sinnvollen, überschaubaren Ganzen. Auch wenn wir Menschen immer nur Stückwerk erkennen können: Gott sieht unser Leben als Ganzes an. Daran zu glauben, helfe ihm zum Leben, so der Freund. Ich fühle mich verstanden und seltsam getröstet, obwohl sich an der Situation noch nichts geändert hat, und wie zuvor das Tagesgeschehen von Verunsicherung und Sorge geprägt ist. Dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, steht schon in der Bibel. Das sagt sich so schön, wenn alles gut ist – aber wann ist schon alles gut. Darum beeindruckt mich das Bild vom Teppich, in den ich verwoben bin und der ein Bild für mein Leben ist. Auch wenn ich das Teppichmuster gerade nicht erkenne, ist es dennoch da. So mitten drin fällt mir die Übersicht vielleicht schwer, aber von oben betrachtet steht mein Leben in einem Zusammenhang, und auch, wenn mir die Einzelheiten wirr erscheinen, ergibt mein Leben doch in seiner Gesamtheit einen Sinn. Gott kennt ihn und sieht mich, darum halte ich mich an ihn. Mag sein, momentan ist kein Land in Sicht, aber ich weiß, dass hinter dem Horizont der sichere Hafen auf mich wartet. Schon Paulus kann sagen: Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. (1. Korintherbrief 13,12) Wollen wir über die Fragen und Sorgen in der Krise nicht verlernen, zu leben. Wir haben so viele gute Erfahrungen gemacht und können auf viele gute Jahre, gute Begegnungen zurückblicken. Uns ist so vieles geschenkt worden, wir hatten so viele Möglichkeiten, haben Grund zu danken für so vieles. Erinnern wir uns doch! Erzählen wir uns davon! Kann sein, wir werden dadurch das Teppichmuster wieder ein wenig besser erkennen können und uns ermutigt und getröstet dem großen Teppichweber anvertrauen. Er hält uns in seiner Hand geborgen.
Peter Kanehls
11.04.2021
Sein Licht macht Graues bunt
„Geht das jetzt immer so weiter?“, fragte mich dieser Tage ein Kollege. Seine Stimme klang zugleich ungehalten und besorgt. „Wir brauchen endlich eine Perspektive.“, so seine Forderung. „Die Menschen werden ungeduldig. Viele haben längst ihren Humor verloren.“ Ich konnte ihm da nur zustimmen. Wenn ich mir die neuesten Nachrichten anschaue oder an Gespräche in meiner Gemeinde denke, dann stehen wir wohl alle vor ungeahnten Herausforderungen, sind verunsichert und ratlos und hoffen, dass Corona doch bitte bald hinter uns liegen möge. Schon jetzt ist klar: Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Wir sind nicht mehr dieselben. Alle unsere Erfahrungen erscheinen in anderem Licht und unser ganzes Leben fühlt sich an, als stünde es täglich unter einem Vorbehalt. Und tatsächlich: Alles, was wir mittel- oder längerfristig planen wollen oder müssen, ist gänzlich ungewiss. Wie soll man das aushalten? Anneliese Bungeroth schreibt: „Manchmal sehen wir die Zukunft vor uns wie eine nachtfarbene Wolkenwand, die nichts anderes zu bringen scheint als Unwetter, die uns ängstigen. Aber dann steht plötzlich das Zeichen am Himmel, das Gott bereits Noah geschenkt hat zur Besiegelung seines Gottesbundes. Der Bogen verbindet die Erde mit dem Himmel. Ich will mich nicht ängstigen lassen von grauen Wolken im Leben. Hinter uns steht das LICHT! Es macht Graues farbig – es bringt dem Grauen das Leuchten bei. Auch für uns gilt der Gottesbund. Seit Ostern wissen wir es noch tiefer.“ Anneliese Bungeroth weist auf den Regenbogen hin, als ein Zeichen der Treue Gottes, die der ganzen Schöpfung gilt und uns Menschen Mut machen und Trost schenken soll. Mehr noch: Hier zeichnet sich eine Perspektive ab, die uns inmitten der pandemischen Unwetter Halt und Zuversicht geben kann. Denn wir sind noch immer in Gottes Hand, soviel steht fest. Keine schlechte Basis, wenn es darum geht, nun nach vorne zu schauen und eine Strategie zu entwickeln, die Krise „abzuwettern“ und zu überwinden. Wir kommen ja von Ostern her und wissen, dass das Leben stärker ist, als alle grauenvollen Mächte. Er, der das Licht ist, Jesus Christus, hat sich selbst mit Leib und Seele dafür hingegeben, dass wir Hoffnung und Zukunft haben können. Wir wissen zwar noch nicht, wie das aussehen wird, weder für uns persönlich, noch für unsere menschliche Gesellschaft, doch dass wir von Gott gehalten sind und leben werden, gehört für mich zu den großartigen Versprechen Gottes an uns. Er wird sie einlösen, und wir werden leben. Vielleicht, dass wir hier und da mittun und uns für eine bessere Welt engagieren, dass wir durchlässig werden für das LICHT, das hinter uns steht, wie Anneliese Bungeroth es ausgedrückt hat. Wir könnten mithelfen, dem Grauen das Leuchten beizubringen. Jedenfalls: Es wird jetzt nicht immer alles so weitergehen, wie der Kollege und viele andere das befürchten. Denn „seit Ostern wissen wir es noch tiefer“, Gott überlässt diese Welt nicht einfach sich selbst. Er hat uns berufen, ihm zu vertrauen, sein Licht in die Welt zu tragen und zuversichtlich zu leben, heute und in Zukunft. Dies ist unsere Hoffnung, und zugleich unser Gebet.
Peter Kanehls
04.04.2021
Es ist besser, ein Licht anzuzünden - Ostern
Ostern feiern wir das Leben. Überall brechen jetzt die Blüten auf, das Frühjahr beschert uns mehr Tageslicht. Alles wird hell und freundlich. Wie gut! Das schöne Wetter zieht uns raus an die frische Luft, doch gleich stellen sich auch Bedenken ein, denn da draußen müssen wir Abstand halten und Maske tragen. Und wir dürfen uns nicht mit allen unseren Lieben treffen. Viele Menschen finden das bedrückend. Eine Infektion kann schlimme Folgen haben und uns zuletzt sogar das Leben kosten. Das will niemand. Vielleicht wird ja bald ein Ausweg aus der Pandemie gefunden. Wir werden sehen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, wie man so sagt.
Meine Großmutter pflegte in Tagen der Krankheit oder der Sorge zu sagen: „Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.“ Bemerkenswerte Lebenseinstellung! Viele Menschen haben das tatsächlich getan in diesem Corona-Jahr, haben Kerzen entzündet und ins Fenster gestellt und so ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben. Viele haben auf Gutes und Schönes hingewiesen und selber dazu beigetragen, dass wir alle miteinander uns nicht überwältigen lassen von dunklen Gedanken und verzweifeltem Tun, haben geholfen, ermutigt, getröstet, begleitet wo es ging als ein menschliches Licht, das die Dunkelheit der Krise erhellt.
Ostern feiern wir das Leben, das stärker ist, als der Tod. Wir Menschen haben nicht alle Zeit der Welt, sondern nur ein paar Jahrzehnte Lebenszeit – der eine mehr, die andere weniger. Wenn’s zu Ende geht, sagen viele resigniert: Das war’s dann wohl. Andere aber begehren dagegen auf: Das kann‘s doch nicht gewesen sein. Recht haben sie. Auch ich bin davon überzeugt, dass wir nicht dazu bestimmt sind, nur für siebzig, achtzig Jahre zu leben. Ich glaube, wir Menschen sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen, um vertrauensvoll mit ihm zu leben, erst hier und dann dort, wo kein Tod mehr sein wird. Manche nennen das die Ewigkeit, andere sprechen von Gottes Herrlichkeit.
Wir können schon hier und jetzt eine Ahnung von Gottes Herrlichkeit bekommen, wenn wir uns anhören, was Jesus sagt. Als sein Freund Lazarus gestorben war, sprich er mit dessen Schwester Marta. Jesus sagt zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ (Joh 11,25f.)
Wir feiern Ostern als den Beginn des neuen Lebens, eines Lebens das stärker ist, als der Tod. Der hat nur noch ein vorläufiges Recht und muss am Ende klein beigeben. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern der Tod. Jesus hat ein Licht entzündet in der Dunkelheit der Welt und den Tod überwunden. Er hat das Leben durchgesetzt ein für alle Mal und gibt Hoffnung allen, die sich auf ihn einlassen und ihm vertrauen. Das allerdings hätte er schon gern von uns: Unser Vertrauen. Jesus ist gekommen, um alle Welt mit Gott zu versöhnen und uns seiner Liebe zu versichern. Sein Leben ist stärker, seine Liebe ist größer als der Tod.
Mag sein, es geschieht noch immer viel Schlimmes in der Welt. Es sind oft Menschen daran schuld. Wir sind noch unterwegs durch Licht und Schatten und fragen uns manchmal, wohin das noch führen soll. Aber seit Ostern geschehen und Jesus auferstanden ist, haben wir eine Perspektive – mehr noch, eine Hoffnung, die nie mehr vergeht. Wir gehen ins Leben, und es hat schon begonnen.
Ich wünsche uns allen ein frohes Osterfest unter dem Segen des himmlischen Vaters, dessen Liebe und Lebendigkeit uns allen gilt in Jesus Christus.
Peter Kanehls
28.03.2021
Wie soll ich dich empfangen?
Am Sonntag vor Ostern wurden früher nicht nur in Dänischenhagen die Konfirmationen begangen. Am Palmsonntag gab es dann einen feierlichen Einzug der einzusegnenden Mädchen und Jungen in die Kirche, alle fein herausgeputzt und zurecht gemacht für den großen Tag. Mit der Konfirmation wurden ihnen die kirchlichen Rechte und Pflichten verliehen, durch die sie nun quasi erwachsen wurden. Fertig waren sie damit noch nicht – aber wer ist mit vierzehn/ fünfzehn Jahren schon fertig? Auch mit vierundzwanzig oder mit vierundsechzig sind wir hoffentlich noch nicht fertig, sind noch immer unterwegs, entwickeln uns weiter und lernen dazu auf der großen Wanderung durch unser Leben. So heißt es bei Gerhard Tersteegen: Ein Tag, der sagt dem andern, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Keine Wanderung ohne Ziel. Wohin bist Du unterwegs? Gibt es Mitreisende? Wohl dem, der nicht allein ist. Der feierliche Einzug der jungen Leute in die Kirche zu ihrer Konfirmation macht eins deutlich: Sie sind jetzt Teil einer Gemeinschaft. Gemeinsam mit vielen anderen Menschen vertrauen sie sich Jesus Christus an. Es ist immer ein besonders erhebender Moment, wenn die Mädchen und Jungen zusammen mit der Gemeinde ihren Glauben bekennen. Wie zur Bestätigung ist da nicht selten Gottes Nähe spürbar – und genau das will Konfirmation ja sein: Bestätigung. Die Prozession der Konfirmanden in die Kirche erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Auf einem friedlichen Esel reitet Jesus in die Stadt. Seine Jünger begleiten ihn. Ein Ruf wird laut. Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn! Man erkennt in ihm den von Gott gesandten König. Die Menschen jubeln ihm zu, halten Palmzweige in die Höhe, um ihn zu ehren, und sie breiten wie zu einem roten Teppich ihre Kleider auf dem Weg aus. Sie ahnen: In Jesus kommt Gott selbst zu ihnen. Nun müsste sich aller Kummer wenden. Und über Raum und Zeit hinweg reihen sich die Konfirmanden in dieses Geschehen ein, werden Teil der Gemeinschaft um Jesus. – Ist es nicht so, was wichtig ist, sagt man nicht nur einmal? Der Einzug Jesu in Jerusalem wird im Gottesdienst am Palmsonntag gelesen und am 1. Advent. Dabei ändert sich die Blickrichtung: Wie soll ich dich empfangen, und wie begegne ich dir?, heißt es in dem bekannten Adventslied. Ja, hier wird’s plötzlich persönlich. Der Einzug Jesu erfordert meine und Deine Antwort. Gott kommt zur Welt, und Jesus möchte bei Dir und bei mir einziehen und Platz in unserem Leben haben. Sind wir bereit?
Peter Kanehls
21.03.2021
Lebendiges Licht
Heute möchte ich Sie zum Gottesdienst in unserer Kirche in Dänischenhagen einladen. Immer sonntags um 10.00 Uhr feiern wir in unserer schönen alten Kirche miteinander. Wenn ich bedenke, dass an diesem Ort schon seit über siebenhundertfünfzig Jahren Christen zusammenkommen, um zu beten und zu singen und Gott zu loben, dann merke ich, wie ich innerlich still werde. Meine Gedanken kommen zur Ruhe und staunen darüber, dass etwas so lange Zeit Bestand haben kann. Immerhin kommen auch noch heute nicht wenige Menschen zur Kirche, leben als Christen, vertrauen sich dem lebendigen Gott an. Diese schöne alte Kirche in Dänischenhagen, dieses alte Gebäude, dessen Mauern schon so viele Menschen haben beten und singen hören, dieser ganz besondere Raum hilft dabei, sich zu besinnen und sich Gott zu nähern. Ich merke das z. B. daran, ob die Kerzen brennen oder nicht. Vier Leuchter stehen bei uns auf dem Altar, vier Kerzen, die nicht gerade viel Licht geben, vergleicht man sie mit anderen Lichtquellen. Und doch ist der Unterschied, ob nämlich die Kerzen auf dem Altar brennen oder nicht, frappierend. Ohne Kerzen wirkt der Altar leblos und irgendwie verlassen. Das Kerzenlicht aber, und sei es auch noch so klein, verwandelt den ganzen Raum. Wer zu Hause echte Kerzen benutzt, schätzt das gemütliche Licht. Es dienst eben nicht nur zur Beleuchtung, sondern schafft Atmosphäre. Es blendet nicht, sondern wirkt anziehend. Die sanfte Bewegung der Flammen macht das Licht lebendig, und der warme Kerzenschein verleiht allem einen festlichen Glanz. Das schätzen wir auch im Gottesdienst. Das lebendige Licht der Altarkerzen aber ist mehr, als nur festliche Dekoration. Es erzählt von Jesus Christus, von dem es im Johannesevangelium heißt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) So haben die Wachskerzen eine ganz besondere symbolische Bedeutung. Sie verzehren sich selbst und geben alle Energie als Licht und Wärme vollständig an ihre Umgebung ab. Sie behalten nichts für sich, sondern geben alles, was sie haben, hin. Auf Jesus bezogen bedeutet das: Er verzehrt sich selbst in seiner Hingabe an die Menschen und strahlt dabei Gottes Liebe aus. Seine Hingabe ist so vollständig, dass er es auf sich nimmt, am Kreuz von Golgatha sein Leben zu lassen. Er gibt sein Leben hin als Lösegeld für uns, die wir in allerlei schuldhaften Verstrickungen stecken, die wir unser Leben verfehlen, in Abhängigkeiten geraten sind, oder von Gott nichts wissen wollen. Menschen, deren Dasein dadurch dunkel geworden ist, die ohne Hoffnung sind und nichts, als den Tod vor Augen haben, dürfen nun befreit aufatmen, denn Jesus macht ihr Leben hell. So lassen wir uns „anstecken“ von den Lichtern auf dem Altar und einladen zu dem, der das Licht ist, Jesus Christus. Sein Licht leuchtet auch für uns und macht unser Leben hell. Ich möchte Sie zum Gottesdienst einladen, hatte ich gesagt. Womöglich haben Sie bedenken wegen Corona. Das kann ich verstehen. Auch ich bin vorsichtig geworden und verhalte mich anders seit dieser Pandemie, die vor gut einem Jahr begann. Meine Güte, was für ein Jahr! Wenn Sie sich nicht zur Kirche trauen, was ich gut verstehen kann, dann zünden Sie doch am Sonntagmorgen in einem stillen Moment bei sich zu Hause ein Licht an und denken, wenn Sie die kleine Flamme betrachten, an den großen Gott, der sich uns geschenkt hat in Jesus Christus. Machen wir uns klar: Keine Pandemie, keine Dunkelheit, kein Leid und keine Krankheit können ihn uns nehmen. Die Kerzenflamme wird irgendwann verlöschen, Gottes Licht aber bleibt und weist uns den Weg durch unsere Tage, wenn wir auf Jesus achten. Vielleicht sehen wir uns demnächst einmal zum Gottesdienst in unserer Kirche? Das wäre schön. Bis dahin aber bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet.
Peter Kanehls
14.03.2021
Gottes Herz schlägt für uns
Viele Menschen schätzen, was Jesus von Nazareth gesagt und getan hat, auch, wenn sie sich selbst nicht als Christen bezeichnen würden oder regelmäßige Kirchgänger sind. Doch dass Jesus nicht nur ein guter Mensch war, sondern dass in ihm Gott selbst zu uns gekommen ist, das zu glauben tun sich viele Menschen schwer. Warum sollte Gott sich zu uns Menschen begeben, wir haben doch seine Gebote und wissen, was gut und böse ist. Offenbar reicht dieses Wissen aber nicht aus, denn sonst dürfte es unter uns Menschen nichts Böses mehr geben. Doch noch immer werden Menschen zu Opfern, tun Menschen einander Böses an, kommen ums Leben. Um daran etwas zu ändern hat Gott sich selbst auf den Weg gemacht. Was hat ihn dazu bewogen? Dazu hörte ich die folgende Geschichte: Ein fremder König in einem fernen Land mit einer fremden Kultur hatte einen Minister, der Christ wurde und seinen Glauben auch öffentlich bekannte. Er erklärte, dass er an Jesus Christus glaube, den König über Himmel und Erde, der in diese Welt gekommen sei, um sie von Schuld und Tod zu erlösen. Dem fremden König in einem fernen Land war das unverständlich. Er sagte: „Wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann erlasse ich meine Befehle und gebiete meinen Dienern, das genügt. Warum sollte der König aller Könige – wenn es ihn denn gäbe – selbst in diese Welt kommen?“ Der König fragte sich, ob er seinem Minister noch vertrauen könne und beschloss, ihn wegen seiner Entscheidung für den christlichen Glauben zu entlassen. Da er ihn aber sehr schätzte, versprach er ihm seine Entscheidung gnädig zu überdenken, wenn er eine Antwort auf seine Frage wüsste (warum nämlich der König des Himmels selbst zur Welt kommen sollte). „Gewährt mir einen Tag Zeit, Majestät“, erwiderte der Minister, „und ich will Euch antworten.“ Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genauso zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Als der König am folgenden Tag eine Bootsfahrt machte, hielt sich der Schnitzkünstler am Flussufer auf, und auf ein mit dem Minister vereinbartes Zeichen warf der Schnitzkünstler die Puppe ins Wasser. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen, und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang auch er ins Wasser. Der Minister fragte ihn später, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. „Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste!“ erwiderte der König. Und der Minister antwortete: „So hat sich auch Gott nicht damit zufriedengegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herab zur Welt kommen, um uns aus dem Verlorensein zu retten.“ Sie werden vielleicht sagen, dass es sich nur um eine Geschichte handele. Und doch veranschaulicht sie sehr schön, worin das Evangelium – die Gute Nachricht für uns Menschen besteht. Gott überlässt dies Welt nicht einfach sich selbst. Wir sollen nicht in verloren gehen im Chaos dieser Zeit, nicht allein bleiben in Konflikten oder Krisen, die uns zu schaffen machen. Gott kommt uns nahe, damit wir ihn finden. Er vertraut sich uns an, damit wir uns ihm anvertrauen. Er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wer betet, nimmt gewissermaßen Platz auf dem Schoß Gottes und lehnt seinen Kopf an die Brust des himmlischen Vaters. So ist Christsein eine Herzensangelegenheit, ein Leben in der Nähe des liebenden Vaters, und ich wünsche uns allen, dass wir gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung und der Sorgen wegen all der Veränderungen, die durch die Corona-Krise über uns gekommen sind, Gottes Herzschlag wieder spüren können und darin gewiss werden, wie wertvoll wir für ihn sind: Seine geliebten Kinder.
Peter Kanehls
07.03.2021
Wie sind denn die Menschen hier so?
Unsere Mitmenschen können aber manchmal auch ganz schön schwierig sein. Sogar zu Hause. Es gibt Tage, da kann man es einfach niemandem recht machen. Man redet aneinander vorbei, produziert Missverständnisse und am Ende „hängt der Haussegen schief“. Oder die Nachbarn. Sie lärmen im Treppenhaus oder mähen zu den unmöglichsten Zeiten den Rasen. Oder die Verwandtschaft. Kommen wie selbstverständlich vorbei, ohne Bescheid zu sagen und bleiben, ob es gerade passt oder nicht, erwarten Kaffee und Kuchen und verstehen nicht, weshalb man so sparsam guckt. Okay, solche Verwandten gibt es gar nicht, aber die Spannungen, die ich hier andeute, haben wir wohl alle schon erlebt. Woran liegt da bloß. Warum können die Menschen nicht freundlich und in Frieden miteinander leben? Ein Stück weit - nette Redewendung, oder? – kann ich mir das schon erklären. Dass es auf der politischen Weltbühne Interessenskonflikte gibt und mancherlei Krisen zu bewältigen sind, das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Aber so unter uns und von Mensch zu Mensch? Eigentlich müssten sich alle doch nur ein wenig „am Riemen reißen“, und schon sähe die Welt hell und freundlich aus, finde ich. Da lese ich von einem alten Mann, der draußen vor der Stadt auf einer Bank sitzt und dem Kommen und Gehen der Menschen gelassen zuschaut. Ein Fremder tritt auf ihn zu. „Wie sind denn die Menschen hier in der Stadt so?“, fragt der Fremde. „Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt gewesen seid?“, entgegnet der Alte. „Wunderbar. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Sie waren freundlich, großzügig und stets hilfsbereit.“ Antwortet der alte Mann: „So etwa werden sie hier auch sein.“ Ein anderer Fremder kommt vorbei, sieht den Alten sitzen und spricht ihn an: „Wie sind wohl die Menschen hier in der Stadt gesinnt?“, fragt er. „Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt gewesen seid?“, lautet die Gegenfrage. „Schrecklich. Sie waren gemein, unfreundlich, keiner half dem anderen.“ „So, fürchte ich, werden sie auch hier sein.“ Ich bin verblüfft und betroffen. Könnte es sein, dass die Menschen, sei es in der Familie, in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft und erst recht unterwegs in der Stadt oder bei der Arbeit mir sozusagen einen Spiegel vorhalten? Ich muss mich fragen lassen, wie ich von anderen erwarten kann, mich zuvorkommend zu behandeln, während ich sie kaum beachte. Wenn das alle täten, wie schlimm wäre es um unsere Gesellschaft bestellt. Nun gibt es zweifellos Schwierigkeiten im Umgang miteinander. Schwierigkeiten, die ich gerne abstellen würde. Fragt sich nur, wie. Die kleine Geschichte von dem alten Mann im Gespräch mit den Fremden erinnert mich an ein Sprichwort. Sie kennen es bestimmt, liebe Hörerin, lieber Hörer. Es will mehr, als eine Redewendung sein. Kein Sprichwort ist nur Sprachspielerei. Sprichworte wollen tatsächlich eine Art Hilfestellung in den mancherlei Schwierigkeiten des Lebens sein. Dieses also heißt: „Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Klare Sache. Ich will nicht, dass man mich betrügt, also betrüge ich nicht. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht lästern, nicht vorverurteilen. Klingt gut. Ich vermeide einfach alles, was mich in Schwierigkeiten mit anderen bringen könnte. Interessanterweise ist dieses Sprichwort eine Verballhornung der sog. Goldenen Regel aus der Bergpredigt Jesu. Da klingt das so: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! (Mt 7,12) Aber das bedeutet: Keine Vermeidungsstrategie, sondern Initiative! Wenn ich möchte, dass es freundlicher in der Welt zugeht, dann sollte ich damit anfangen. Mag sein, das ist riskant, und ich werde Enttäuschungen erleben, aber auf die Länge gesehen wird diese Strategie aufgehen. Ein kleiner Beitrag für ein verändertes Klima in der Stadt, oder zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Wir müssen uns dafür nicht verbiegen. Machen wir uns klar, dass Gott selbst den Anfang gemacht hat, als er in Jesus Christus zu uns gekommen ist, um uns seiner Liebe zu versichern. Er fragt nicht, ob wir alles richtig gemacht und immer sauber geblieben sind, sondern er schenkt uns seine Aufmerksamkeit und Liebe einfach so, weil er es gut mit uns meint. Das verändert uns. Er macht den Anfang und hofft, dass wir uns darauf einlassen können und ihm darin folgen mögen. In dem Bewusstsein, geliebt zu sein, müsste das doch eigentlich möglich sein, oder? Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit, und dann immer besser. Was meinen Sie, wie sind wohl die Menschen dort, wo Sie leben? Warum wohl? Was würden Sie sagen?
Peter Kanehls
28.02.2021
Worte die uns helfen zu leben
Der 2. Sonntag in der Passionszeit heißt Reminiszere. Das klingt lateinisch und ist es auch. Einige Sonntag im Kirchenjahr tragen lateinische Namen. Sie beziehen sich auf das Psalmgebet im ersten Teil des Gottesdienstes und nehmen ein Stichwort daraus auf. Heute also Reminiszere, das heißt „Gedenke!“ Der dazugehörige Vers aus Psalm 25 geht so: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind!“ (Ps 25,6) Warum ich das erzähle? Bis heute muss ich am Sonntag Reminiszere an meinen alten Lateinlehrer denken, und an ein geflügeltes Wort, das er uns damals beibrachte. Thema war damals die unterschiedliche Betonung lateinischer Verben. Um uns ein für alle Mal einzuprägen, wie dieses Wort zu betonen sei, gebrauchte er einen Merkvers, der den Fehler enthält, den es zu vermeiden gilt, und das klingt dann so: „Am Sonntag Reminiszére putzen die Jäger die Gewehre.“ Ob es sich dabei auch noch um Jägerlatein handelte, müssen die Jäger unter uns mal sagen.
Eselsbrücken, Gedächtnisstützen, Merkverse – sie wollen uns helfen, uns unsere Lebenseinstellung zu vergegenwärtigen, oder uns nachhaltig daran erinnern. An diesen kurzen Aussprüchen können wir unser Tun und Lassen überprüfen, und feststellen, ob wir uns selbst noch treu sind. Der Volksmund kennt viele solcher Sprichworte, Worte wie „Voller Bauch studiert nicht gern“, oder „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen“, oder auch „man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, kennen sicher noch viele und ganz andere Sprichworte, und es wäre sicher ein lohnenswertes Gespräch, sich darüber einmal auszutauschen.
Ob dabei auch Ihr Konfirmationsspruch zur Sprache käme? Oder der Tauf- oder Trauspruch? Oft ist es der Trauspruch, an den sich viele Paare noch erinnern.
Mit unseren Konfirmanden schauen wir uns in den Wochen vor ihrer Konfirmation ihre Taufurkunden an, denn dort ist in aller Regel der Taufspruch vermerkt, den sie zumeist als Säugling schon bekommen haben, was in der Regel dreizehn, vierzehn Jahre zurück liegt. Für sie ist das fast immer die erste bewusste Begegnung mit diesem Bibelwort, das damals am Taufstein über ihnen ausgesprochen wurde. Nicht selten sind die Jugendlichen erstaunt und bewegt davon, dass sie schon einmal in ihrem Leben mit Gott in Berührung gekommen sind. Da wurde ihnen ein Segen mitgegeben, eine Verheißung oder eine Ermutigung – Worte, die sie damals noch gar nicht verstehen konnten, und die doch schon eine Bedeutung für sie hatte – eine Bedeutung, die sich ihnen jetzt erst zu erschließen beginnt – Worte, die ihnen Orientierung schenken und sie tragen können. Im Gespräch mit den Konfirmanden fragen wir manchmal, ob ihnen jetzt vielleicht ein Zusammenhang auffällt, zwischen dem Bibelwort zu ihrer Taufe damals und ihrem Leben heute. Und tatsächlich entdeckt manch einer einen roten Faden – ein Fädchen vielleicht nur – eine Bewahrung, die sich bewahrheitet, ein Zuspruch, der sich erfüllt hat.
Ich selbst bin nach meiner Konfirmation in den Jugendkreis der Kirchengemeinde gegangen, und dort haben wir auch in der Bibel gelesen und etliche Verse auswendig gelernt – freiwillig und mit viel Spaß dabei, denn wir gestalteten das zu einen sportlichen Wettbewerb. Viele dieser Bibelworte sind mir bis heute präsent oder fallen wir bei passender Gelegenheit ein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mir damals einen Schatz an Worten anlegen konnte, die mich bis heute tragen und mir die Güte und die Liebe Gottes in Erinnerung rufen und aktuell bewusst machen. Es ist, als ob Gott selbst daran anknüpft, bei mir anklopft, sich ins Gespräch bringt und mir zu verstehen gibt: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. (Jer 31,3) Wer wollte das bestreiten? Wer mir das ausreden? Wenn mir dabei dann Menschen aus meiner Vergangenheit einfallen, wie alte Lehrer oder andere Wegbegleiter, wird mir auch bewusst, was und wieviel ich ihnen verdanke. Nicht zuletzt sind es die Eltern, die mir manche Worte mit auf den Weg gegeben haben. Mein Vater war Handwerker und hier im Norden zu Hause. Er sagte gern: „Beeten scheev hett Gott leev“. (Bisschen schief hat Gott lieb.) Ein Trost für alle, die sich irgendwie unvollkommen empfinden oder sich ungeliebt erleben.
Egal, was andere über uns sagen, im Zweifelsfall hat immer die Bibel recht, die uns der Liebe Gottes versichert. So dürfen wir die Bibel persönlich nehmen, können einzelne Verse mit uns führen und in uns tragen und in uns zu Worten Gottes werden lassen – Worte, die uns erfüllen und uns begleiten und uns helfen, zu leben.
Peter Kanehls
21.02.2021
Christus hat keine Hände
In der Sakristei in unsrer Kirche hängt ein altes hölzernes Kruzifix. Nicht besonders kunstvoll, und auch sonst eigentlich nicht der Rede wert. Es hängt dort, weil sich sonst nirgendwo ein Platz dafür gefunden hat, denn das Kreuz ist aus hellem Holz, der mit Messingschrauben daran befestigte Jesus allerdings ziemlich dunkel gebeizt. Das irritiert den Betrachter und scheint nicht zu passen. Als ob Kreuz und Korpus nicht zusammengehören. Doch es sind die Arme, die mich immer wieder betroffen machen, wenn mein Blick auf dieses Kruzifix fällt. Es sind die Arme. Dort, wo sie kurz vor den Achselhöhlen Jesu an seinen Körper angesetzt worden sind, klafft jeweils rechts und links ein mehrere Millimeter großer Spalt. Als ob die Arme ursprünglich gar nicht zu diesem Jesus gehört hätten. Nun mag ich mir einen Jesus ohne Arme nicht vorstellen. Das wäre sicher kein ästhetischer Genuss, aber ästhetisch ist hoffentlich kein Kruzifix nirgendwo auf der Welt, denn die Vorstellung, dass ein Mensch am Kreuz hängt und Stunden oder gar Tage einen qualvollen Tod stirbt, müsste eigentlich jedem Betrachter die Sprache verschlagen. Womöglich haben wir uns bei Kirche zu sehr an den gekreuzigten Christus gewöhnt, als dass sein Anblick uns noch groß aufregen würde. Vielleicht haben viele kunst- und wertvoll gestaltete Kruzifixe dazu beigetragen. Mag sein. Beim Anblick des Gekreuzigten in unsrer Sakristei mit seinen abgetrennten und angeflickten Armen fiel mir ein, was ich neulich irgendwo aufgeschnappt habe. Jemand hat gesagt:
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,
um seine Arbeit heute zu tun.
Er hat keine Füße, nur unsere Füße,
um Menschen auf seinen Weg zu führen.
Er hat keine Lippen, nur unsere Lippen,
um Menschen von ihm zu erzählen.
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,
um Menschen auf seine Seite zu bringen.
Wir sind die einzige Bibel
Die die Öffentlichkeit noch liest.
Wir sind Gottes letzte Botschaft,
in Taten und Worten geschrieben.
Dies, wie gesagt, fiel mir ein, und plötzlich ergibt das schlecht zusammengesetzte Kruzifix in der Sakristei einen Sinn und geht mich an – mich und die Gemeinde und alle, die sich als Christen bekennen. Ist es nicht so: Gott kommt durch Menschen zu Menschen. Sie begegnen dem auferstandenen und erhöhten Herrn in uns, seinen Nachfolgern. Wie sonst könnten Menschen Jesus Christus kennen lernen, von ihm erfahren, mit ihm in Berührung kommen. Und das nicht etwa nur sonntags in der Kirche, sondern alltags und überall, wo Christen lebt. Es ist nun nicht so, dass Christen die besseren Menschen wären. Das nicht. Aber als Christen haben wir die verändernde Kraft der Liebe Gottes erfahren, eine Liebe, sich selbst verschenkt und sich für diejenigen einsetzt, die sich verloren haben in Schuld und Scham, die verzweifelt sind und einsam, die nicht zurechtkommen mit sich und anderen, die keine Hoffnung haben, die keinen Sinn in diesem Leben sehen. Wer könnte ihnen zur Hand gehen, wer ihnen davon erzählen, dass die Welt nicht leer ist, wenn nicht wir, die wir darum wissen. Dass wir von Gottes Güte erzählen und mit anderen teilen, was wir durch Jesus Christus erfahren haben, das hilft uns allen, zu leben. Nicht die Dunkelheit zu beklagen, sondern ein Licht anzuzünden, das wird der Welt helfen und die Menschen froh machen. Manchmal sind es nur kleine Gesten. Niemand muss sich überfordern. Doch wenn wir begreifen, dass Christus auch in uns lebt und durch uns zu anderen kommt, wird ein freundliches Wort, eine Blume an der Tür, ein Moment des Zuhörens bei einem Spaziergang, eine Ermutigung oder ein Wort des Trostes, der Liebe Gottes ein Gesicht geben. Mag sein, das machen dann wir. Oder ist es nicht doch Christus, der das in uns bewirkt und durch uns tut?
Peter Kanehls
14.02.2021
Valentinstag
„Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“, fragt der kleine Hase seine Mama und sucht nach dem passenden Vergleich. Nach einigen Versuchen findet er den treffenden Ausdruck: „Von hier bis zum Mond und wieder zurück“. So nachzulesen in einem schön aufgemachten Kinderbuch, das nicht nur für Kinder gedacht ist. Mich beschäftigt die Frage. Wissen unsere Lieben denn, wie lieb wir sie haben? Und woran können sie das sehen? „Ach Schatz, du weißt doch, dass ich dich liebe.“ Ist das so? „Woher denn, wenn du es mir nicht gelegentlich zeigst.“ Am 14. Februar ist Valentinstag. Ein Tag für Verliebte und Romantiker, so heißt es. Er soll zurückgehen auf einen Heiligen Valentin, der im dritten oder vierten Jahrhundert in Italien gelebt und dort das Martyrium erlitten haben soll. Das klingt nicht besonders liebevoll. Immerhin haben die Märtyrer damals in der immer wieder aufflammenden Christenverfolgung ihr Leben gelassen aus Liebe zu Christus, den sie um keinen Preis der Welt verleugnen und verraten wollten. Ich denke, am Tag der Verliebten und Romantiker gäbe es sicher andere und näher liegende Beispiele, als einen antiken Märtyrer, oder? Obwohl – so eine unerschütterliche Liebe, so eine unerschrockene Hingabe ohne Wenn und Aber, so ein vorbehaltloses und ausschließliches Ja, das wünschte sich vermutlich jeder von uns. Erleben aber nicht alle Liebenden ihre Liebe als eine überwältigende unwiderstehliche Kraft? Hat sie nicht gleichsam etwas Heiliges an sich? Da kommt die Verbindung mit einem Heiligen Valentin doch irgendwie gelegen. Sie verleiht der Liebe zweier Menschen gleichsam etwas Göttliches. Selbst solche Pare, die sonst mit Kirche und christlichem Glauben nicht viel im Sinn haben, sind für einen „himmlischen Anstrich“ ihrer Liebe durchaus offen. In Abwandlung eines Spruches von Matthias Claudius könnten wir sagen: „Die Liebe zweier Menschen wird im Himmel beschlossen und auf Erden vollzogen.“ Mir gefällt daran, dass Gott nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr in die Beziehung zu dem von mir geliebten Menschen einbezogen ist. Denn von Gott heißt es in der Bibel auch: „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1. Joh 4,16) Bemerkenswert. Die Liebe gehört zum Wesenszug Gottes, und wenn Liebe uns bewegt und erfüllt, dann hat das ganz viel mit Gott zu tun. Oder anders: Wo die Liebe fehlt, da ist auch Gott fern. Gott hat sich deshalb auf den Weg gemacht und ist zu uns in diese Welt gekommen in Jesus Christus. An ihm können wir die Liebe Gottes in Person sehen und erfahren, können uns ein Beispiel nehmen, uns einladen und anstecken lassen und uns darin üben und dabei mithelfen, der Welt ein anderes Gesicht zu geben, ein liebevolles, ein freundliches, ein barmherziges Gesicht. Machen wir es, wie Gott: Werden wir Mensch und fangen wir damit an. Vorzugsweise bei denen, mit denen wir zusammen sind und die wir liebhaben. Die anderen, die es uns schwer machen, die uns unsympathisch sind und uns immer wieder Probleme bereiten – die wollen wir nicht vergessen. Auch sie sollen die verändernde Kraft der Liebe erfahren. Aber am Valentinstag gilt meine Aufmerksamkeit nun doch erst einmal meinem Schatz. „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ Wann haben wir das unseren Liebsten zuletzt gesagt und gezeigt? Und wann haben wir uns klar gemacht, wie sehr Gott uns liebt? Es ist „tatsächlich Liebe“, die ihn bewegt. Der große Paul Gerhardt sagt das so: „Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast.“ Ist das nicht schön? Gott schließt uns in seine Arme, uns und alle - die Liebenden und die, die sich verlassen und verloren vorkommen. Ich wünsche uns heute und alle Tage wenigstens einen Moment täglich, an dem wir diese Umarmung spüren können. Dies wird uns in die Lage versetzten, auch anderen von dieser Erfahrung zu schenken. Denn „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
Peter Kanehls
07.02.2021
Reden mit Gott
Oft will es mir nicht recht gelingen. Ich bin abgelenkt, ich denke gar nicht erst daran, ich habe keine Zeit, mir fehlen die Worte. Ich weiß einfach nicht, was ich beten soll und wie. Ich könnte ja ein Vaterunser sprechen, doch außerhalb der Kirchenmauern und nur so für mich allein kommt mir das seltsam vor. Es heißt, Gott verstehe alle Sprachen der Welt. Und dass man ihm keine „Gedichte“ aufsagen, sondern ihm das Herz ausschütten sollte. Wirklich? Sollte ich den großen Gott mit meinen klein(lichen) Anliegen behelligen? Nun ja, immerhin hat der große Gott sich klein gemacht, ist Mensch geworden und zur Welt gekommen in Jesus Christus. Er hat alles Menschliche, allzu Menschliche selbst kennen gelernt und durchgemacht. Das macht ihn glaubwürdig. Womit aber fange ich an? Vielleicht, dass ich mir fürs Erste die Worte für mein Gebet leihe? Worte von solchen Menschen, die schon Erfahrung mir dem Gebet haben? Worte wie diese, die ein Senior aus England mit unvergleichlichem englischem Humor, augenzwinkernd und doch in aller Ernsthaftigkeit vor Gott ausgesprochen hat. Hier betet einer vertrauensvoll, erfahrungsgesättigt, selbstkritisch, weise. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig, weil er weiß, dass Gott ihn wichtig nimmt. Niemand muss so beten, aber als eine Übung für das stille persönliche Gespräch mit Gott sind diese Worte gut zu gebrauchen.
Also:
Herr, du weißt es besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung an Weisheit tut es mir leid, sie nicht weiterzugeben, aber du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu, und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.
Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten – nur um etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der anderen übereinstimmt.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert, wie möglich. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt ein Heiliger bin, aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, und verleihe mir, Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.
Und wie, um unser Gebet zu bestätigen, einen Griff dran zu machen und einen Punkt zu setzen, können wir Amen sagen. Das heißt: So soll es sein. Möge es so geschehen. In Gottes Namen. Amen.
Peter Kanehls
31.01.2021
Bunte Gesellschaft an Bord
Axel Kühner, Pastor, Evangelist und Autor vieler Sachbücher, hat im Laufe seines Lebens mehrere Bücher mit kurzen alltagstauglichen geistlichen Impulsen zusammengestellt. Sie sind auch für mich eine unerschöpfliche Quelle der Ermutigung. So vergleicht er in den Überlebensgeschichten für jeden Tag, Neukirchen-Vluyn ³1993, einmal die verschiedenartigen Tiere in der Arche Noah mit den so unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde:
„War das eine Vielfalt in der Arche! Der alte Noah und seine Frau, die jungen Söhne und deren Frauen. Und dann die vielen verschiedenen Tiere. Ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Da ist der Windhund, der allen voran ist, und die Schnecke, die immer hinterherkommt. Das gibt es in einer Gemeinde, Menschen, die schnell und vorneweg sind, und andere, die hinterherkommen. Aber sie gehören beide dazu, und Gott hat sie lieb. Da ist der Löwe mit seinem mächtigen Haupt und seinen starken Pranken, der König der Tiere, und die kleine Maus, die nur piept und um die Ecke huscht. Starke Menschen mit Führungsqualitäten und schwache Menschen, die scheu ihr „Piep“ sagen, gehören in der Gemeinde zusammen. Und was sie rettet, ist nicht ihre Stärke, sondern das In-der- Arche-Sein. Da ist die Nachtigall, die so schön singt, dass alle begeistert sind, und der Spatz, der nur so herbe pfeift. Jeder wirkt in der Gemeinde auf seine Weise, und Gott freut sich an der Vielfalt der Gaben und Stimmen. Da ist der Elefant mit seiner massigen Gestalt und dicken Haut. Wo der hintritt, wächst lange nichts mehr, und an seiner Haut scheint alles abzuprallen. Aber es gibt auch das zarte Reh, das so leicht verletzt und gekränkt ist, zerbrechlich und empfindsam. Bei Gott wohnen Menschen mit einem dicken Fell und solche mit dünner Haut in einem Schiff. Wie massig und unempfindlich sind die einen, wie verletzt und schnell verwundet die anderen. Aber Gott hat sie alle sorgsam in seiner Hand. Da ist die Eule, deren Weisheit man rühmt, und das Schaf, das man für dumm hält, nur weil es den Mund nicht auftut. Auch in der Gemeinde leben Menschen mit Weisheit und Erkenntnis. Und andere hält man fälschlicherweise für dumm, nur weil sie still und schweigsam sind. Aber Gott sieht ihr Herz an und freut sich über alle, die in der Arche leben. Da ist der Pfau mit der wunderbaren Farbenpracht seines Federkleides, die allen ins Auge fällt, aber auch die Ratte, vor der sich viele ekeln. Manche Menschen in der Gemeinde können ihre Gaben zur Geltung bringen, dass es eine Pracht ist. Andere denken, sie wären wie eine Ratte, die niemand mag. Aber Gott mag sie und lässt sie in seiner Arche überleben. Was uns Menschen rettet, sind nicht unsere Vorzüge oder Qualitäten. Was uns zugrunde richtet, sind nicht unsere Schwächen und Fehler. Sondern wir überleben in Gottes Gemeinde und gehen außerhalb seiner bergenden Liebe verloren.“ (Axel Kühner)
Peter Kanehls
27.01.2021
Verantwortlich handeln
Dieser Tage las ich von Corona-Müdigkeit. Klar, auch ich mag von dieser ganzen Corona-Thematik auch schon bald nichts mehr hören. Aber das wäre unverantwortlich. Während einige die Pandemie nicht ernst nehmen, sind andere schwer erkrankt. Ich finde beides unerträglich und will das nicht akzeptieren. Sind wir doch für unser Leben verantwortlich – immer vorausgesetzt, wir sind noch Herr unsrer Sinne. Also: Verantwortung ist das Gebot der Stunde. Wie wir sie wahrnehmen können? „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst!“ Das hat Jesus gesagt, und er wusste, wovon er sprach. Du sollst Deinen Nächsten so behandeln, wie Du behandelt werden möchtest! Machen wir uns klar: Nicht meine, sondern die Bedürfnisse meines Nächsten sind der Maßstab für verantwortliches Handeln, auch unter Corona-Bedingungen. Mag sein, in unserer Welt gibt es noch immer viel Schlechtes und Schlimmes. In Jesus aber hat Gott Verantwortung für diese Welt übernommen. Weil wir ihm am Herzen liegen, überlässt er uns nicht uns selbst. Noch eins hat Jesus gesagt: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Jesus zwingt niemanden zu etwas, sondern macht selbst den Anfang und tut, was er sagt. Ohne die vielen Christen, die ihm darin gefolgt sind, die auf ihn gehört und zu Herzen genommen haben, was er gesagt hat, wäre es noch viel schlimmer um diese Welt bestellt. Mag sein, die Verantwortung ist groß, aber wir sind damit ja nicht allein, können einander ergänzen, trösten, ermutigen, aufmerksam machen, beten, beistehen.
Peter Kanehls
24.12.2020
Worüber das Christkind lächeln musste
Als Josef mit Maria von Nazareth her unterwegs war, um in Bethlehem anzugeben, dass er von David ab-stamme - was die Obrigkeit so gut wie unsereins hätte wissen können, weil es ja längst geschrieben stand -, um jene Zeit also kam der Engel Gabriel, heimlich noch einmal vom Himmel herab, um im Stalle nach dem Rechten zu sehen. Es war ja sogar für einen Erzengel in seiner Erleuchtung schwer zu begreifen, warum es nun der aller-erbärmlichste Stall sein musste, in dem der Herr zur Welt kommen sollte, und seine Wiege nichts weiter als eine Futterkrippe. Aber Gabriel wollte wenigstens noch den Winden gebieten, dass sie nicht so grob durch die Ritzen pfiffen, und die Wolken am Himmel sollten nicht gleich wieder in Rührung zerfließen und das Kind mit ihren Tränen überschütten, und was das Licht in der Laterne betraf, so musste man ihm noch einmal einschärfen, nur bescheiden zu leuchten und nicht etwa zu blenden und zu glänzen wie der Weihnachtsstern. Der Erzengel stöberte auch alles kleine Getier aus dem Stall, die Ameisen und Spinnen und Mäuse, es war nicht auszudenken, was geschehen konnte, wenn sich die Mutter Maria vielleicht vorzeitig über eine Maus entsetzte! Nur Esel und Ochs durften bleiben. Der Esel, weil man ihn später ohnehin für die Flucht nach Ägypten brauchte, und der Ochs, weil er so riesengroß und so faul war, dass ihn alle Heerscharen des Himmels nicht hätten von der Stelle bringen können. Zuletzt verteilte Gabriel noch eine Schar Engelchen im Stall herum auf den Dachsparren, es waren solche von der kleinen Art, die fast nur aus Kopf und Flügeln bestehen. Sie sollten ja auch bloß stillsitzen und Acht haben und sogleich Bescheid geben, wenn dem Kinde in seiner nackten Armut etwas Böses drohte. Noch ein Blick in die Runde, dann hob der Mächtige seine Schwingen und rauschte davon. Gut so. Aber nicht ganz gut, denn es saß noch ein Floh auf dem Boden der Krippe in der Streu und schlief. Dieses winzige Scheusal war dem Engel Gabriel entgangen, versteht sich, wann hatte auch ein Erzengel je mit Flöhen zu tun! Als nun das Wunder geschehen war, und das Kind lag leibhaftig auf dem Stroh, so voller Liebreiz und so rührend arm, da hielten es die Engel unterm Dach nicht mehr aus vor Entzücken, sie umschwirrten die Krippe wie ein Flug Tauben. Etliche fächelten dem Knaben balsamierte Düfte zu, und die anderen zupften und zogen das Stroh zurecht, damit ihn ja kein Hälmchen drücken oder zwicken möchte. Bei diesem Geraschel erwachte aber der Floh in der Streu. Es wurde ihm gleich himmelangst, weil er dachte, es sei jemand hinter ihm her, wie gewöhnlich. Er fuhr in der Krippe herum und versuchte alle seine Künste, und schließlich, in der äußersten Not, schlüpfte er dem göttlichen Kinde ins Ohr. "Vergib mir!", flüsterte der Floh atemlos, "aber ich kann nicht anders, sie bringen mich um, wenn sie mich erwischen. Ich verschwinde gleich wieder, göttliche Gnaden, lass mich nur sehen, wie!" Er äugte also umher und hatte auch gleich einen Plan. "Höre zu", sagte er, "wenn ich alle Kraft zusammennehme und wenn du stillhältst, dann könnte ich vielleicht die Glatze des heiligen Josef erreichen, und von dort weg kriege ich das Fensterkreuz und die Tür" ... "Spring nur", sagte das Jesuskind unhörbar, "ich halte still!" Und da sprang der Floh. Aber es ließ sich nicht vermeiden, dass er das Kind ein wenig kitzelte, als er sich zurechtrückte und die Beine unter den Bauch zog. In diesem Augenblick rüttelte die Mutter Gottes ihren Gemahl aus dem Schlaf. "Ach, sieh doch!" sagte Maria selig, "es lächelt schon!"
Aus Karl Heinrich Waggerl, Und es begab sich..., Inwendige Geschichten, Salzburg o. J.
Mit dieser Geschichte grüße ich Sie, liebe Leserinnen, lieber Leser ganz herzlich und wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Christfest. Peter Kanehls
20.12.2020
Gott kommt durch Menschen zu Menschen - 4. Advent
Gott kommt durch Menschen zu Menschen. Ich habe das oft erlebt. Da kam kein Blitz vom Himmel, kein spektakuläres Wunder ist geschehen. Und doch war da Gottes Handeln spürbar in meinem Leben, war Gott spürbar nah. Oft aber scheint sich Gott bedeckt zu halten so, als ob er tatsächlich nicht da wäre, und ich beginne, unsicher zu werden und mich zu fragen, was das bedeuten soll, was ich gerade erleben und durchmachen muss. Inge Müller beschreibt ihre Erfahrungen so: „‚Jetzt bitte nicht!‘ ‚Keine Zeit, ein andermal...‘ ‚Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?‘ Wie oft weise ich ab: das kleine Kind, dessen vorsichtige Frage meinen straffen Terminplan sprengt. Die alte Dame, die anscheinend nicht verstehen will, wie schnell die Uhren heutzutage ticken. Die umständliche Kollegin, die schüchterne Freundin ... Abgewürgt, weggeklickt, vom automatischen Anrufbeantworter gelöscht. Und wie oft werde ich selbst abgewiesen. Wenn mir alles über den Kopf wächst. Wenn ich mich endlich einmal schwach zeigen und anlehnen möchte. Wenn ich um Verzeihung bitten will. Und dann diese Behauptung: Gott hört uns. Gott hat ein offenes Ohr für uns und ist immer zu sprechen. Durchgängig. Tag und Nacht. Ohne Sprechzeiten und Gebührenanzeiger, Vorbehalte und voreilige Patentrezepte. Kann ich es glauben? Von jemandem, den ich nur mit dem Herzen wahrnehme, nicht sehe, nicht höre? Wo kann ich spüren, dass ich wirklich gehört und angenommen werde? Vielleicht am ehesten dort, wo ich im Alltag nicht auf taube Ohren stoße. Wo ich einfach ankommen und reden darf. Wo ich selbst mein Ohr leihe — ohne Zeitnot, großzügig und aufmerksam. Gott braucht uns Menschen sicher nicht notwendig, um seine Nähe zu beweisen. Doch vielleicht sind unsere Ohren, Arme und Herzen der kürzeste und der schönste Weg für Gott, in unsere Welt zu kommen und unter uns erfahrbar zu werden.“ (Text von Inge Müller) Und ich denke: Wenn das so ist, dann kann es sein, dass Gott sogar auch durch mich zu anderen kommen kann – durch mich und auch durch dich. So einfach kann Glaube sein, und Gott kann zu uns allen kommen. In der Krippe in Bethlehem hat er den Anfang gemacht und ist geworden wie wir, damit wir werden wie er. Gott kommt durch Menschen zu Menschen. Ist es nicht so? Hören wir, sehen wir, spüren wir nur hin. Gott ist näher, als wir denken – uns und unseren Nächsten.
Peter Kanehls
12.12.2020
Maranatha: Der "zweite" Advent - 3. Advent
Advent ist eine geheimnisvolle Zeit. Sie erzählt uns von dem, der gekommen ist und kommen wird, Jesus Christus. Das er gekommen ist damals in Bethlehem, das gehört inzwischen zum Allgemeingut. Aber das er eines Tages ein zweites Mal kommen wird, das ist vielen Menschen unbekannt oder unangenehm. Die Schriftstellerin Inge Müller schreibt dazu: „ ‚Maranatha‘ lautet eines der letzten Worte der Bibel. Es stammt aus der Offenbarung des Johannes, dem einzigen durchgehend prophetischen Buch des Neuen Testamentes, voller geheimnisvoller Symbole, Bilder und Visionen für die Zukunft. „Maranatha" ist ein Wort aus der Muttersprache Jesu, dem Aramäischen. In dieser dreitausend Jahre alten Sprache, die heute noch in der syrisch-orthodoxen Kirche lebt, sind uns viele Passagen des Alten Testamentes sowie einige Worte von Jesus selbst überliefert wie: ‚Talitha kumi — Mädchen, steh auf‘. ‚Eloi, eloi lama sabachtani — Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.‘ Jesus und seine Jünger haben so miteinander gesprochen — und die ersten Christen übernahmen den die Bibel beschließenden Ausruf: ‚Maranatha! — Unser Herr, komm!‘ auf den der Schreiber Jesus antworten lässt: ‚Ja, ich komme bald.‘ Die Urchristen benutzten dieses Wort als Grußformel und drückten damit ihre ganze Hoffnung aus, Jesus werde nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt bald zu ihnen zurückkehren, das Reich Gottes, dessen Nähe er verkündet hatte, ein für alle Mal auf Erden aufrichten, alle Schmerzen beenden, alle Tränen trocknen, dem Tod für immer die Macht nehmen und eine neue Schöpfung begründen. Mit dem sehnsüchtigen Ausruf ‚Maranatha — Unser Herr, komm! Komme bald!‘ wird deutlich, dass die ersten Christen gleichsam in einer Art zweiten Advent lebten. So wie die gläubigen Juden — was wir uns oft nicht klar machen — bis heute den Messias erwarten (wohlgemerkt: seine erste Ankunft, denn in Jesus erblickten sie ja nicht den von Gott gesandten Erlöser) — so erwarten Christen bis auf den heutigen Tag seine zweite Ankunft, seine Wiederkehr. Weihnachten ist demnach ein Anfang, eine Verheißung und ein Versprechen, das noch eingelöst werden muss — und immer wieder in den seitdem vergangenen zweitausend Jahren haben die Menschen das Kommen des Herrn, die Endzeit und die Neue Schöpfung erwartet, herbeigesehnt und herbeigebetet, aber auch gefürchtet. Manche glaubten, den Zeitpunkt berechnen und sogar festlegen zu können, wer bei dem gleichzeitig zu erwartenden Endgericht gerettet würde und wer mit Sicherheit nicht zu den Auserwählten gehöre. Um die erste Jahrtausendwende herum häuften sich Gedichte, poetische Romane, Predigten und dringende Aufrufe zur Umkehr, denn man glaubte den Jüngsten Tag nahe. Wir alle haben die zweite Jahrtausendwende nach Jesu Geburt erlebt: Damals hörte man nur noch wenig von den letzten Tagen der Welt, eher fürchteten wir einen Zusammenbruch des weltweiten Datennetzes, der Stromversorgung und der Fahrpläne von Zügen und Flugzeugen. ‚Maranatha — Unser Herr, komm!‘ Können wir diese Worte noch in den Mund nehmen? Rechnen wir damit, wollen wir, sehnen wir uns danach, dass er wiederkommt? Vielleicht nicht als hilfloses kleines Kind diesmal, sondern tatsächlich in großer Macht und Herrlichkeit? Dass er vollendet, was wir vom nahen Reich Gottes verstanden und mit unserer kleinen Kraft, mit Liebe und voll guten Willens begonnen haben — an den geringsten seiner Brüder und Schwestern — und das alles abgebrochen wird, was himmelschreienden Hass und Ungerechtigkeit, Unfrieden, Leid und Tod in die Welt brachte. Dass Gott wiederum alles in die Hand nimmt, wie am Anfang seiner Schöpfung, und ein neues Paradies schafft, in dem der Löwe beim Lamm liegt, und das Kind mit der Natter spielt. Wir können uns immer wieder einüben in diese Haltung der Erwartung und der Hoffnung: Wohl zu der halben Nacht, wenn das Morgenlicht weit ist und die Sorgen überhandnehmen. Mitten im kalten Winter, wenn der Frühling fern scheint. So fern und so unglaublich wie das erste Grün, das wir uns kaum vorstellen können an den kahlen Ästen, die Wiederkehr der ersten Blüten im Schnee — oder die Wiederkehr eines Menschen, der schon einmal unsere Welt verändert hat.“ (Text von Inge Müller, Lahr 2011) Ich wünsche uns allen diese Zuversicht auf das Neue, nämlich auf die Erneuerung der Welt durch Jesus Christus und die Veränderung der Herzen. Sie hat ja begonnen. Möge sie sich bald schon vollenden.
Peter Kanehls
06.12.2020
Die Legende von den drei Bäumen - 2. Advent
Es wuchsen einmal drei Bäume im Lande Israel nebeneinander in Eintracht. Wenn es das Wetter zuließ und Wind oder Hitze ihnen nicht gar zu sehr zusetzten, pflegte jeder der drei Bäume seinen Träumen nachzuhängen. „Wenn ich erst einmal gefällt bin", sagte er erste, „dann will ich eine mächtige, eisenbeschlagene Truhe werden, und ich will den größten Schatz der Welt in mir tragen.' Und ich", trumpfte der zweite auf, „ich werde ein festes Schiff, das den wildesten Sturm unbeschadet übersteht und seine Passagiere sicher nach Hause bringt." „Ich weiß noch nicht, was meine Aufgabe sein wird", tat der dritte Baum geheimnisvoll, „aber dass es etwas ganz Großes ist, das spüre ich." Und dann schwiegen sie wieder und jeder malte sich im Stillen seinen Traum aus, immer noch ein wenig farbiger und großartiger. Nun wurden sie eines Tages tatsächlich gefällt, die drei Bäume — alle drei am gleichen Tage. „Jetzt wird mein Traum in Erfüllung gehen!" dachte jeder von ihnen. Aber ach! Aus dem ersten zimmerte man keine Schatztruhe, sondern einen schlichten Futtertrog, aus dem zweiten kein stattliches Schiff, sondern ein Fischerboot, den dritten aber hieb man zu einem groben Balken zurecht und stellte ihn mit vielen anderen solcher Balken in einen mächtigen hoch ummauerten Hof. Monate und Jahre lang blieben die drei, was sie waren: ein Futtertrog, ein Boot, ein Balken. Bis eines Nachts ein Mann und eine junge Frau in dem Stall Schutz suchten, in dem der Futtertrog stando Und mitten in der Nacht gebar die Frau einen kleinen Jungen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in den Futtertrog, der sich darob alle Mühe gab, sich recht ausladend und bequem zu präsentieren, damit das kleine Kind doch einigermaßen angenehm läge. Und seltsam: Auf einmal hatte er das Gefühl, als ob sein Traum sich doch noch erfüllt hätte: dass er den größten Schatz der Welt in sich trüge. Und wiederum viele Jahre später stieg ein Mann mit seinen Freunden in das Fischerboot, das da am See lag, und sie stießen vom Ufer ab. Mitten auf dem See aber erhob sich ein so starker Sturm, wie ihn das Boot niemals in all der Zeit erlebt hatte, die es den See befuhr. Gerade aber, als das Boot glaubte, seine Planken müssten zerbrechen, da erhob der Mann seine Hand und gebot dem Wind und den Wellen. Und siehe, sie beruhigten sich, und das Boot wusste, dass es seinen Sturm überstanden hatte wie so manches stattliche Schiff ihn nicht erlebt, und dass es seine Passagiere nun sicher ans Ufer bringen würde. Drei Jahre später ergriffen kräftige Soldatenhände den Balken, der seine Zeit in dem ummauerten Hof zugebracht hatte, und luden ihn einem geschundenen, zer- schlagenen Mann auf, der das Holz bis hinauf auf einen Berg vor der Stadt tragen musste. Dort kreuzigten die Soldaten den Mann, indem sie seine Hände mit Nägeln an den Balken schlugen. Und während sie den Balken aufrichteten und er seine eigenen Schmerzen fühlte und auch etwas von den unendlich viel stärkeren Schmerzen des gemarterten Menschen, dessen Gewicht er trug, spürte er, dass dies die geheimnisvolle Aufgabe war, auf die er so lange gewartet hatte. Er hätte nicht sagen können, wozu er dabei diente und worin der Sinn dieses Leides lag — aber dass es etwas ganz Großes war, das spürte er.
(Nach einer mündlich überlieferten Legende aus Israel)
Peter Kanehls
29.11.2020
Ein Stern huscht vorbei - 1. Advent
In diesen Tagen ist er wieder bei uns eingekehrt, jener alte Freund, der sich immer dann einstellte, wenn meine Großmutter die bunte Blechdose mit den Lebkuchen öffnete; wenn sie Orangenschalen auf dem Kohleofen trocknete und Tannenzweige ins Feuer warf. Ich meine jenen vertrauten Geruch aus Pfefferkuchengewürz, Mandeln und Honigkuchen, der sich im Haus verbreitete, wenn St. Nikolaus die Stiefel füllte und meine Mutter uns Kinder zum Keksbacken einlud. Es duftet nach Weihnachten überall dort, wo auch heute die guten alten Weihnachtsbräuche gepflegt werden und sie für uns große Leute eine Brücke zurück in die Kindheit schlagen. Oft nur für kurze Augenblicke - doch die sind kostbar. Ich muss ich an ein Wortspiel denken, mit dem uns unser Johannes vor vielen Jahren als kleiner Junge einmal so fröhlich gestimmt hat, als er seiner Schwester bei einer Bastelei zusah - sie versuchte, einen geschweiften Weihnachtsstern auszuschneiden - und sagte: "Ich will auch so einen Schnupperstern basteln." Sternschnuppe - Schnupperstern! Eigentlich ist der Weihnachtsstern ja ein Komet, der mit seinem leuchtenden Schweif hell und klar am Himmel steht. Wie anders konnte er die Weisen aus dem Morgenland in Erstaunen und in Bewegung versetzen und ihnen den Weg zur Krippe zeigen. Und doch: der Gedanke an den Schnupperstern lässt mich nicht los. Dieser Stern huscht vorbei; kaum ist er entdeckt, ward er schon nicht mehr gesehen. Geheimnisvoll und fast verborgen ist dieser Schnupperstern. Nur, wer ihn sucht, mit ganzer Aufmerksamkeit auf ihn wartet, wird ihm vielleicht begegnen. Der "Schnupperstern" mag uns ein Wegweiser zu dem Geheimnis der Heiligen Nacht sein. Es ist ein unaufdringliches, zärtliches und schwer zu lösenden Geheimnis, für das alle unsere Worte zu laut, zu grob, zu undeutlich sind. Wir sind eingeladen, zu schnuppern, uns vorsichtig zu nähern und mit ganzer Aufmerksamkeit, mit ganzem Herzen auf das Kind in der Krippe zu achten, den leisen Glanz aufzunehmen, der von ihm ausgeht und der uns tief drinnen anrühren und erfüllen möchte. Wir sind eingeladen, uns in Erstaunen und in Bewegung versetzen zu lassen, um Gott zu begegnen, der uns als Menschenkind schon entgegenkommt. Wir sind eingeladen, als Gemeinde Jesu zu leben und Gemeinschaft zu gestalten, uns einander vorsichtig und mit ganzer Aufmerksamkeit zu nähern - nicht aufdringlich und grob - um hilfreiche und gute Erfahrungen des Glaubens und der Güte Gottes machen zu können. Wir sind eingeladen, unsere Hoffnung zu feiern und uns immer wieder neu für Gottes heilende und helfende Gegenwart zu öffnen. Ich wünsche Ihnen, liebe Anruferin, lieber Anrufer, in dieser Adventszeit viele solche herzerwärmende Momente. Mögen sie uns allen leuchten, wie Sterne am Wegesrand – „Schnuppersterne“ die uns von der Liebe Gottes erzählen.
Peter Kanehls
22.11.2020
"...leben, auch wenn wir sterben."
„Bei Kirche gehen die Uhren anders“, sagt man. Und tatsächlich: Der 22. November ist der „Letzte Sonntag im Kirchenjahr“. Wie? Schon zu Ende? Da kommt doch noch der ganze Dezember mit Advent und Weihnachten und so weiter. Tatsächlich beginnt mit dem 1. Sonntag im Advent das neue Kirchenjahr. Seltsam, oder? Kirche geht mal wieder nicht mit der Zeit, könnte man denken. Warum wohl? Ginge Kirche mit der Zeit und unterwürfe sich der Mode, dann wäre sie so, wie die allermeisten Moden bald Geschichte. Das Kirche mit den Menschen gehen sollte, steht auf einem anderen Blatt. Nun also Jahreswechsel Ende November. Es handelt sich um einen Übergang. Wir lassen das Alte zurück und gehen dem Neuen entgegen. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr bedenken wir die „letzten Dinge“, wie man so sagt, also unsere Vergänglichkeit, und dass wir auch in diesem Jahr Menschen verloren, Verluste erlitten, Abschied haben nehmen müssen. Zugleich erzählt der Advent uns davon, dass das nicht das Ende ist. Denn Gott ist zur Welt gekommen in dem Kind in der Krippe, und er wird wiederkommen, um diese Welt zu vollenden und zu erneuern. Dieser Tage erzählte mir jemand von seiner kleinen Tochter, die sich große Sorgen mache, dass Weihnachten wegen Corona ausfallen könnte. Aber gemach! Weihnachten kann gar nicht ausfallen; es hat doch längst stattgefunden. Christus ist(!) zur Welt gekommen. Das kann keine Pandemie ungeschehen machen. Wir Christen warten nicht mehr auf das Christkind, wir warten auf Gottes neue Welt und hoffen auf Erlösung von dem Bösen.
Das Böse allerdings umgibt uns hier noch vielfältig. Die „Krux“ ist, dass wir sterblich sind, und dass auch wir dermaleinst diesen letzten Weg werden antreten müssen. Gott aber hat den Keim des Neuen in uns bereits angelegt, und seitdem wächst das neue Leben mitten unter uns und wird sich vollenden, wann und wie Gott will. Er(!) gibt uns ein neues Zuhause, und wir werden mit allem, was uns bedrückt und traurig macht, bei ihm aufgehoben sein und von ihm getröstet werden. Diese ungewöhnlichen Gedanken „liegen nicht im Trend“. Überhaupt ist Sterben und Tod eher angstbesetzt und wird gern verdrängt. Erst recht, wenn man Gott nicht kennt oder nichts von ihm wissen will. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr erinnert uns daran, dass wir eine Zukunft bei Gott haben. Die daran anschließenden Sonntage im Advent wollen uns davon erzählen, wie diese Zukunft aussieht.
Im letzten Buch seiner Offenbarung schreibt der Seher Johannes:
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. (Off 21,1-5a.6)
Wenn das keine Perspektive ist! Wir dürfen leben – erst hier, und dann dort, wo Leid und Tod keine Rolle mehr spielen, und wir Gott von Angesicht sehen und zu Hause sein werden. Angekommen, aufgehoben, getröstet, gehalten, geliebt. Er hat damit begonnen, als Christus in unser Leben gekommen ist, und dieses Neue wird wachsen und wird dauern – heute und alle Tage bis in Ewigkeit.
Amen.
Peter Kanehls
15.11.2020
Wie können wir denn leben?
Am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von Krieg, Gewalt, Flucht und Vertreibung. Wie können wir denn leben in einer Welt, die einfach nicht davon los kommt, dass Menschen einander Gewalt antun. „Wer ist denn mein Nächster?“, wird Jesus gefragt. Es ist die Selbstgerechtigkeit, die in dieser Welt so viel Schaden anrichtet. „Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht", hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt. Jesus erzählt stattdessen von einem, der unter die Räuber fiel. Verdorben ist die Welt, in der wir leben, und auch wir leben unvollkommen, fragwürdig, selbstbezogen, ob es uns gefällt, oder nicht. Wir können das beklagen, und tun es nicht nur am Volkstrauertag, aber wir wollen uns nicht damit abfinden. Mitmenschlichkeit ist der Schlüssel zum Leben, wie Gott es sich gedacht hat. „Wem kann ich zum Nächsten werden?“, fragt Jesus zurück. „An wem kann ich als Mitmensch handeln?“ Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit – Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremdlinge aufnehmen, Nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangene erlösen und Tote bestatten – werden, indem wir sie vollbringen, zu Wegweisern in Gottes neue Welt. Der Himmel beginnt hier: In Jesus Christus kommt Gott zur Welt. Er wird geboren in einem Stall, schmutzig und kalt, wird zum Spielball politischer Interessen, arm, hungrig, missverstanden, verfolgt, getötet am Kreuz – hier ist Gott zu finden. Aber auch hier: Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen." Und seinen Jüngern schreibt Jesus ins Stammbuch: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Schwestern und Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Wo wir dieses Evangelium hören und Jesus darin folgen, kann die Welt sich verändern, kommt der Himmel uns nah.
Peter Kanehls
08.11.2020
"Die-auf-dem-Weg-sind"
Als damals die ersten Christengemeinden entstanden, wurden die Anhänger Jesu von ihren nichtchristlichen Zeitgenossen mit einem ungewöhnlichen Namen benannt. Für sie waren die Christen „die auf dem Weg sind“. Man fragt sich, ob das vielleicht ironisch gemeint war, denn viele Christen wurden wegen ihres Glaubens verfolgt und mussten fliehen, nicht wenige wurden getötet. Auch heutzutage werden Christen in manchen Teilen unserer Welt bedroht, verfolgt, vertrieben. Dass es das im 21. Jh. noch gibt, ist unglaublich und schrecklich. Der Name „Die-auf-dem-Weg-sind“ ist dennoch treffend. Machen wir uns klar: Jesus hat die Menschen damals in die Nachfolge gerufen. Gleich zu Beginn seines öffentlichen Auftretens heißt es von ihm: Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. (Mt 4,18-20) So entstand mit der Zeit die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Sie zogen mit ihm durch die Dörfer und Städte in Israel und wurden Zeugen seiner Worte und Taten. Jesus erzählte auf unvergleichliche und faszinierende Weise von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen. Wer seine Rede hörte, wurde tief bewegt, und viele fassten neu Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Man hatte den Eindruck, dass Gott selbst durch Jesus gekommen ist. Das war vor allem dort der Fall, wo Menschen in der Begegnung mit Jesus von Krankheit und Leiden befreit wurden. Heutzutage gibt es so etwas nicht, wird oft behauptet, und darum könne es das damals auch nicht gegeben haben. Wenn aber tatsächlich Gott in Jesus gekommen ist, um auf unaufdringliche Art und Weise zu zeigen, was Gott uns Menschen eigentlich zugedacht hat, dann bekommen die Worte und Taten Jesu einen tiefen Sinn – tiefer, als die immer wieder gern genannte Menschenfreundlichkeit des Wanderpredigers, die nachzuahmen wir durchaus aufgerufen sind. Mit Worten des Apostels Paulus: In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. (2. Kor 5,19) Das war es, was die Menschen in Jesu Nähe spürten, was sie an ihm faszinierte und dazu bewegte, ihr Leben zu bedenken und ihm eine neue Richtung zu geben. Das geschieht auch heute noch vielfach dort, wo Christen von ihrem Glauben erzählen und versuchen, so zu leben, wie sie es bei Jesu gesehen und gelernt haben. „Die-auf-dem-Weg-sind“, so könnten wir auch heute heißen, wir Christen. Jesus selbst hat sich einmal „Der Weg“ genannt. Denn er wollte keine neue Religion gründen, sondern den Menschen dabei helfen, zurück zu Gott zu finden. Gegenwärtig gibt es in Deutschland mehrere christliche Gruppen, die sich den Namen „Weggemeinschaft“ gegeben und sich zu einer christlichen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verbindlich zusammengeschlossen haben. So z. B. der seit 1982 bestehende Verein WegGemeinschaft in Cuxhaven. Leben und Arbeiten in der Nachfolge Jesu ist im 21. Jh. noch immer aktuell. In der Begegnung mit diesen Gemeinschaften werden Menschen ermutigt, sich Gott anzuvertrauen und in dieser Welt mit ihren Herausforderungen bewusst als Christen zu leben. Auch als Kirchengemeinde in Dänischenhagen versuchen wir, mit unseren begrenzten Möglichkeiten und in aller Unvollkommenheit dem Weg zu folgen, der Jesus heißt, unseren Glauben zu leben und einander Anteil an unserem Leben zu geben. Gott ist in Jesus zur Welt gekommen, damit sie zu ihm finden und ihn kennen und ihm vertrauen kann. Vor Ort und im Alltag will sich dieses Vertrauen bewähren. Als Christen wollen wir mithelfen, dass Gott in unserer Welt kein Fremder bleibt, sondern vielen Menschen ans Herz wachsen kann. Dabei leitet uns ein Wort von Paulus, der schreibt: Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. (Phil 3,12)
Amen.
01.11.2020
In der Krise nicht ohne Gott
Nun also doch der zweite „Lock-down“. Die Krise hat uns alle fest im Griff, und ob wir Ende November wieder in einen geregelten Alltag zurückkehren können, oder nicht, wagt niemand voraus zu sagen. Das alles verunsichert uns zutiefst. Ängste stehen auf und machen vielen von uns das Herz schwer. Das Jahr 2020 wird als das Jahr der Corona-Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen. Wollen hoffen, dass nicht auch noch das Jahr 2021 dazu kommt. Wir haben schon Ostern nicht feiern können, weil im Frühjahr alle Gottesdienste abgesagt wurden. Werden wir denn in zwei Monaten Weihnachten feiern können? Und was, wenn nicht? Auf dem Hintergrund der Krise wird mir die Zeit vor Weihnachten, die Adventszeit, mit ihren traditionellen Symbolen wichtig. Da ist der Kranz aus immergrünen Zweigen. Er trägt vier Kerzen. Sie sollen die Dunkelheit vertreiben. Dazu werden sie entzündet – erst eine, dann zwei und so weiter. Langsam wird es hell und heller – ein Bild für die Erlösung, auf die die Welt wartet. Denn das gehört auch zum Advent, dass die Dunkelheit, die noch in unsere Welt herrscht, nicht dauern wird. Alles, was uns jetzt noch bedrückt, wird ein Ende haben. Johannes beschreibt im letzten Buch der Bibel das neue Jerusalem als einen Ort, an dem Gott und Menschen zusammen wohnen werden so, wie einst und ursprünglich in der Paradieserzählung am Anfang der Bibel, als Gott und Mensch schon einmal in vertrauter Gemeinschaft miteinander lebten. Dass es zum Bruch kam, hat Gott nicht davon abgehalten, sich um seine Menschen zu kümmern und sich zu bemühen, uns zurück zu gewinnen. „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das erste ist vergangen.“ (Off 21,4) Christen glauben, dass wir dahin unterwegs sind. Das große Ziel ist Gottes Herrlichkeit, da wir Platz nehmen dürfen an seiner Festtafel um mit IHM das Leben zu feiern. Das ist uns versprochen, uns, und allen, die sich Gott überlassen und sich Jesus Christus anvertraut haben. Doch noch sind wir nicht dort. Und wenn dann Krisen und Katastrophen über uns hereinbrechen, ist die Betroffenheit groß. Mein Gott, warum? Warum ich? Warum so? Zur Not können wir die Krise verstehen, können den Erläuterungen der Wissenschaftler folgen, können unser Verhalten ändern und einiges dazu tun, dass alles nicht noch schlimmer wird – doch begreifen können wir die Krise nicht. Jede Verletzung hinterlässt Narben. Nichts ist mehr, wie zuvor. Nun hat jemand gesagt: „Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.“ Damit bin ich wieder beim Adventskranz und seinen Lichtern. Der Kranz wird uns nicht retten, aber seine Symbolsprache verweist uns an den, der uns auch in der Krise nahe ist. Das Immergrün spricht uns vom immerwährenden Leben, dem kein Tod etwas anhaben kann, und die Lichter erzählen von dem, der das Licht ist, weil er der Liebe Gottes ein Gesicht gibt: Jesus Christus. Dies gilt in, mit und unter der Krise. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott nicht gefällt, was die Welt zurzeit aushalten muss. Wir können dazu beitragen, dass die Dunkelheit nicht überhand gewinnt. Lassen wir uns von Jesus Christus anstecken, und helfen wir mit, sein Licht in die Welt zu tragen, gerade auch unter der Krise, damit noch viele von dem großen Ziel erfahren, nämlich der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie beginnt hier und jetzt. Amen.
Peter Kanehls
20.10.2020
"Du machst es uns nicht leicht, an dich zu glauben"
Beim Blättern in einem Heft mit kleinen frommen Texten habe ich heute ein seltsames Gebet entdeckt. Erst hat es mich geärgert, dann hat es mich betroffen gemacht, und schließlich fühlte ich mich ermutigt und getröstet. – Sie fragen sich, was das für ein Gebet ist. Ich will es ihnen gleich vorlesen. Es handelt sich jedenfalls um Worte, die ein Mensch aufgeschrieben hat, um solche wie mich nachdenklich zu machen. Kein billiger Trost. Kein Schönreden – aber auch kein Schlechtmachen. Beten heißt, auf Gott zu hören und mit ihm zu sprechen, eigene Worte, persönliche Gedanken und Empfindungen, dies alles rein aus dem Herzen heraus. Wem, wenn nicht Gott, könnte ich schon alles sagen? Aber mag ich mich ihm auch zumuten mit all dem, was in mir ist und mir selbst oft nicht recht gefällt? – Sie warten noch immer auf den Gebetstext. Augenblick noch! Kommt gleich. Ich habe mich geärgert über den Vorwurf, Gott mache es uns nicht leicht, zu glauben. Dann war ich betroffen wegen der schlechten Verbindung zu ihm, und wegen der Erkenntnis, dass es oft an mir liegt, dass Gott so fern zu sein scheint. Ja und dann fühlte ich mich ermutigt, weil hier jemand aufrichtig zu Gott ist, und ihm trotz all der eigenen Ungewissheiten seinen Herzenswunsch hinhält: Dass du da bist und alles hältst und lenkst“.
Also, da betet einer:
Herr, du machst es uns nicht leicht, an dich zu glauben, mit dir zu rechnen. Du bist wie ein ferner Verwandter, der sich schon lange nicht mehr hat blicken lassen. Es fällt uns schwer, dir ein paar Zeilen zu schreiben, dich kurz anzurufen und dich um etwas zu bitten. Die Verbindung reißt oft ab, bevor sie zustande kommt. Anderes liegt uns näher, kleine Tröster helfen über vieles hinweg. Wir vermissen dich nicht oft, und doch wäre es gut zu wissen, dass du für die kleinen Leute und auch für die Großen da bist und alles hältst und lenkst. (Knut Wenzel Backe)
Ich muss denken, Gott kann das ab. Er hat keine Probleme mit den Abgründen und Untiefen in mir. Ganz sicher bekümmert es ihn, wenn ich ihn mal wieder aus dem Blick verliere, weil ich ohne es zu merken nur um mich selbst kreise. Daraus kann ich ihm keinen Vorwurf machen, oder? Spüren wir sie noch, die Sehnsucht in uns? Die Sehnsucht danach, wahrgenommen und angenommen zu sein? Endlich ankommen und leben zu können? Befreit, geheilt, gesegnet? Wie fern ist das alles oft, und liegt nicht nur an uns. Wir können Gott nicht für alles verantwortlich machen, was uns das Leben schwer macht. Aber wir können uns ihm mit all dem überlassen. Ich wünsche uns heute, dass wir – Sie und ich – das ein kleines bisschen besser leben und verstehen können, indem wir uns Gott anvertrauen, egal, wie wir gerade drauf sind. Weil er unsere Herzen kennt, sind wir bei ihm in guten Händen.
Peter Kanehls
04.10.2020
Wo sind die neun? (Lk 17,11-19)
Der Evangelist Lukas erzählt einmal von zehn Männern, die Jesus bitten, sie von ihrem Aussatz zu heilen. Jesus schickt sie zum Priester, sich ihm zu zeigen, und indem sie losgehen, werden sie gesund. Bo Giertz, lange Jahre Pastor in Schweden und Bischof der schwedischen Staatskirche, schreibt dazu:
„Nur einer der geheilten zehn Aussätzigen hält es für nötig, Jesus zu danken. Die anderen zeigen eine geradezu außergewöhnliche Undankbarkeit. Im Allgemeinen vergisst man ja das Danken nicht, wenn man in einer schweren Krankheit um Hilfe gebeten hat und gesund geworden ist. Obwohl auch dies schon eine Art Undankbarkeit ist: wenn man nur dann dankt, wenn man einen »besonderen« Anlass dazu hat.
Es ist normal, wenn ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, ihm nicht für seine Gaben dankt. Das Traurige ist, dass es so viele Menschen gibt, die durchaus mit Gott rechnen, aber die die allermeisten seiner Gaben entgegennehmen, ohne Danke zu sagen. Sie tun dies Tag um Tag. Wie leicht betrachten wir das, was Gott uns jeden Tag schenkt - und was doch mithin ein besonders großes Geschenk ist! — als eine Selbstverständlichkeit. Oder als unser »gutes Recht«. Zum Beispiel, dass wir leben und zur Arbeit gehen können, dass wir unsere Lieben noch haben, dass Essen auf dem Tisch steht und es warm im Haus ist. (Darum liegt durchaus ein Sinn in dem regelmäßigen Tischgebet; es ist mehr als eine altmodische Sitte, die man genauso gut auch sein lassen kann.)
Gott als Dienstleister, dessen Existenz man achselzuckend voraussetzt — das ist der tote Glaube. Gott wird zur Risikoversicherung für Krisenfälle reduziert, zur schnellen Eingreiftruppe, wenn ein Kind nicht nach Hause gekommen ist, der Herzinfarkt droht, die Entlassungswelle im Betrieb beginnt oder die Ernte am Verregnen ist. Dann soll Gott eingreifen, und wenn er das ordentlich und nach unseren Wünschen tut, dann sehen wir Grund zum Danken. Und in einem Jahr mit Missernten denkt so mancher, dass man den Erntedanktag doch eigentlich ausfallen lassen sollte.
Der Fehler ist, dass man nicht mehr weiß, wer Gott ist. Man betrachtet ihn als Feuerlöscher für Notfälle, aber dort, wo er einem am nächsten ist, sieht man ihn nicht mehr: im ganz normalen Alltag, in allem, was wächst und blüht, was lebt und sich regt, auch in seinem eigenen Körper mit all seinen Organen und Zellen. Man ahnt nicht mehr, wie Gott in jedem neuen Augenblick sein göttliches »Es werde! « spricht und wie man jede Minute von diesem Schöpferwort abhängig ist. Und am allerwenigsten ahnt man, dass mitten in der Schöpfung ein Kampf zwischen dem Schöpfer und dem Verderber tobt, in welchem nur Gottes ständige Hilfe und Erbarmen uns retten kann.
Gott kennen — das ist eine nie versiegende Quelle der Dankbarkeit. Die Kunst des Dankens soll das Thema dieser Woche sein.“
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr hat seinen Thron im Himmel er- richtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele! (Aus Psalm 103)
Peter Kanehls
27.09.2020
Kann es sein, dass Gott so was tut?
Der Mann sitzt vor Gram gebeugt vor mir. Tränen stehen in seinen Augen. „Sie ist doch noch ein Kind!“ Er spricht von seiner Enkelin. Sie hat Leukämie. Als er sie in der Klinik besuchen wollte, brach er noch vor dem Gebäude zusammen. Nun schämt er sich. „Was kann ich denn tun? Wo bleibt Gott?“, bricht es aus ihm heraus. Wir halten seine Hilflosigkeit aus, schweigen eine Weile, denken an die Kleine. „Ich bete auch“, sagt er. „Jeden Tag bete ich: Ich muss stark sein, ich muss stark sein. Aber ich schaff das nicht.“ Ich schlage ihm vor, sein Gebet ein klein wenig abzuwandeln: „Lass mich stark sein.“ Er schaut auf. Ich sehe, wie es in ihm arbeitet. Er schaut hoffnungsvoll, entspannt sich. „Danke“, sagt er. „Danke!“ Ein Jahr später. Aufrecht sitzt der Mann vor mir, seine Augen leuchten. „Sie ist wieder ganz gesund.“ Die Kleine, sie geht sogar wieder zur Schule, und sie hat keine Glatze mehr. Ich freue mich mit ihm, als er erzählt, wie fröhlich die Kleine ist. Er kann es noch immer nicht fassen. „Warum musste sie das erleben? Warum musste ich da durch?“ Und dann beschreibt er, wie ihre Krankheit auch ihn verändert hat. „Einmal habe ich mich in eine Kirche gesetzt. Diese Stille! Bin nur dagesessen. Später bin ich immer wieder hingegangen, bin dort gesessen, habe vor mich hingeredet. Sorgen, Fragen, einfach alles. Dann kam die Entspannung, einmal bin ich sogar eingeschlafen. Ich habe auch gebetet. Lass mich stark sein. Es war so unglaublich wohltuend. Kann es sein, dass Gott so was tut? Danke noch mal!“
Ich denke an Psalm 91,15: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. – Ja, ich glaube, dass Gott so was tut.
Peter Kanehls
20.09.2020
Nachdenken und Nachleben
Heute habe einen schönen Text von Pastor Axel Kühner gefunden. Er schreibt: "In früheren Zeiten blieben Kinder, die taub waren, immer auch stumm, obwohl sie voll ausgebildete Sprachorgane hatten. Gehörlose waren immer sprachlose Menschen. Das erinnert uns daran, dass wir nur sagen können, was wir auch hören, nur wiedergeben können, was wir auch empfangen haben. Wir sind nur Empfänger und in allem, was wir von uns geben, angewiesen, es vorher bekommen zu haben. Lebensraum und Lebenszeit, Lebenskraft und Lebensgefährten, Lebenswege und Lebensziel haben wir nicht aus uns. Wir haben sie empfangen und müssen nun richtig mit ihnen umgehen.
Auch unsere äußere Bauart erinnert daran, dass wir mit zwei Ohren doppelt so viel hören, wie wir dann mit einem Mund sagen können. Menschliche Worte sind immer nur Antworten und setzen den Anspruch und Zuspruch voraus. Darum ist beim Erlernen der Mutter- oder Fremdsprache der passive Wortschatz, also, was wir hören und verstehen, immer größer als der aktive Wortschatz, also, was wir sagen und anderen zu verstehen geben können.
Auch das innerste geistliche Leben erinnert uns daran, dass wir Empfänger sind. Jedes Gebet zu Gott ist im Grunde ein Gebet von Gott. Denn Beten und Glauben sind letztlich nicht unsere menschlichen, sondern Gottes Möglichkeiten in uns Menschen. Was wir zu Gott sagen, haben wir zuvor von ihm empfangen. Das wird am deutlichsten am Vaterunser. Jesus hat uns das Gebet gegeben, damit wir es zu Gott beten.
Unser Denken ist Nachdenken, unser Leben Nachleben, unser Sprechen Nachsprechen, unser Beten Nachbeten. Wir sind immer erst Nachfahren, bevor wir dann auch Vorfahren für andere werden. Darum ist die wichtigste Frage, wem wir nachleben, nachdenken, nachfolgen, nachsprechen und nachbeten.
„Und Jesus sah Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach.“
(Markus 2,14)"
Peter Kanehls
13.09.2020
Segen trotz Corona?
Nun also doch: Konfirmation in unserer Kirche. Neunundzwanzig Jungen und Mädchen stellen sich an diesem Wochenende bewusst unter Gottes Segen. Das hätte schon nach Ostern stattfinden sollen, doch dann kam Corona. Die Erfahrungen unter der Krise haben uns alle verändert. Gott aber ist nicht weg. Er ist in jedem Augenblick unseres Lebens mit seiner Aufmerksamkeit bei uns. Das haben schon die Menschen des Alten Bundes erlebt: „Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.“ (Ps 121,4) Nun könnte jemand sagen: Na ja, damals mag das so gewesen sein, aber im 21. Jh? Es geschieht so viel Schreckliches in der Welt. Viele Länder werden von Narzissten, Despoten, Kriegstreibern beherrscht, Millionen Menschen sind auf der Flucht, das Klima geht den Bach runter, und das Virus gibt uns den Rest. Stimmt! Das alles ist schlimm und kann niemandem gefallen. Es sind ja aber von Menschen verursachte Probleme. Wir können sie nicht Gott in die Schuhe schieben. Mich macht das alles manchmal sprachlos. Doch da kommen die Konfirmanden. Sie sehen und erleben zwar die Krise und das Welttheater, doch lassen sie sich taufen und konfirmieren, setzen Zeichen gegen die Angst, strecken sich aus nach dem Segen des lebendigen Gottes und gehen zuversichtlich ihren Weg mit Jesus Christus. Sie haben begriffen: Es gibt einen, der ist größer als alles, der hält diese Welt in seiner Hand und uns mit ihr. Eine Jugend, von Gott bewegt und begeistert, lässt hoffen. Möge sie der Welt zum Segen werden.
Peter Kanehls
06.09.2020
Schritt - Atemzug - Besenstrich
Am ersten September hat für die Meteorologen der Herbst begonnen. Und tatsächlich: Die Tage werden merklich kürzer, das warme Sommerwetter ist vorbei und erste Blätter fallen bereits. Der Autor Armin Beuscher hat sich Gedanken gemacht über einen, dessen Aufgabe es ist, die Blätter von den Straßen und Wegen zu fegen, und er berichtet, was dieser Straßenkehrer bei seiner Arbeit entdeckt hat. Beuscher schreibt: „Atemzug, Schritt, Besenstrich, Atemzug, Besenschritt, Strich, ach Quatsch. Noch mal ganz langsam und von vorne: Schritt, Atemzug, Besenstrich. Genau: Schritt, Atemzug, Besenstrich. Sie fragen sich vielleicht, was ich da mache. Oder Sie kennen es schon? Das Buch Momo? Und den Straßenkehrer Beppo? Beppo gehört zu den Menschen, die in unseren Städten zumeist in Kleingruppen auftreten, mit breiten Besen ausgerüstet sind und die auffallend leuchtende Uniformen tragen. Sie entsorgen den Müll der Straße und die Blätter der Bäume. Ihre Hauptsaison ist der Herbst. Und jener Straßenkehrer Beppo, er könnte auch Antonio, Günter oder Yilmaz heißen, er fegt nicht nur den Mist anderer Leute weg, er hat sich auch Gedanken über seinen Arbeitsstil gemacht. Und sein Ergebnis ist: Schritt - Atemzug - Besenstrich. Vermutlich würde Beppo bald seine Anstellung verlieren. Das Tempo passt nicht. Es passt nicht in unsere hektische Zeit. Dieser Rhythmus stellt sich quer. Quer zu unserer Kurzatmigkeit, quer zu unserer Schnelligkeit, quer zu unserem Lebensmuster. Okay, wenn ich krank bin, oder wenn ich alt bin, dann kann ich mir so etwas erlauben, aber jetzt? Schritt – Atemzug - Besenstrich. Mir fällt es auch schwer. Aber es tut auch gut. Probieren Sie es mal aus. Wenn Sie gleich ins Büro gehen, zur Schule radeln oder im Auto fahren, wenn Sie an einer roten Ampel stehen und genervt Ihren Vordermann anhupen. Idiot, ich habe keine Zeit. Ich muss in zehn Minuten im Geschäft sein, die Kinder müssen noch zur Schule, ich habe ein wichtiges Gespräch, eine Mathearbeit, ich muss meine Bahn kriegen, kein Brot mehr da, und ich muss gleich weg. Schritt - Atemzug - Besenstrich. Es gibt ein tansanisches Sprichwort: „Auf der Eile liegt kein Segen.“ Schritt - Atemzug - Besenstrich.“
Peter Kanehls
30.08.2020
Eine größere Wirklichkeit
Wie lange ist es her, dass ich mich so recht von Herzen gefreut und gelacht habe? Man sagt: Lachen sei gesund. Jemand hat gesagt: Es gibt eine Medizin gegen große Sorgen: Kleine Freuden. Das weiß man auch in Norwegen. Dort leben die glücklichsten Menschen Europas. Beneidenswert, oder? Leider kann ich nicht nordwärts ziehen, um dort mein Glück zu suchen. Stattdessen mühe mich hier ab und schlage mich durch einen grauen Alltag, fühle ich mich manchmal wie gefangen und hoffe, dass das nicht alles immer so weiter gehen wird. Keine schöne Vorstellung, oder? Woher aber sollen die „kleinen Freuden“ kommen? Ich schlage meine Bibel auf und lese, dass man Paulus ins Gefängnis geworfen hat. Klingt nicht gerade ermutigend. Doch was macht er? Um Mitternacht, heißt es, betet er laut und singt und lobt Gott. Alle im Gefängnis hören das, die Lage verändert sich sofort, Mauern fallen, Menschen werden innerlich und äußerlich frei. Dieser selbe Paulus schreibt Jahre später wiederum aus dem Gefängnis: Freut euch im Herrn allewege! Ich beginne zu ahnen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Freude und Lob Gottes. Wer singt und betet und Gott lobt, der setzt einer bedrückenden Wirklichkeit eine andere, größere Wirklichkeit entgegen und schöpft Kraft aus den Zusagen Gottes. Wir haben das schon oft im Gottesdienst erfahren, wenn wir nämlich gemeinsam singen. Da steht Hoffnung auf, fließen uns Kräfte zu, erscheint die Welt in neuem Licht. Nicht zuletzt deshalb feiern wir unseren Gottesdienst sonntags trotz Corona draußen vor(!) der Kirche. Da kann uns niemand das Singen verbieten, und Freude kommt auf. Die Bibel sagt: „Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ (Neh 8,10). Nicht nur in Norwegen.
Peter Kanehls
23.08.2020
Darfs ein bisschen mehr sein?
Jede Woche werden in der Tagespresse die Neugeborenen der Region zusammen mit glücklichen Eltern oder fröhlichen Geschwistern abgebildet. Man sieht es ihnen an: Sie haben so ungefähr das Kostbarste im Arm, was man sich vorstellen kann. Um keinen Preis der Welt würden sie den neuen Erdenbürger hergeben wollen. Wie aber würden wir den Wert eines Menschen beziffern? Wen sollten wir danach fragen? Die Antwort einer Versicherungsgesellschaft sähe sicher anders aus, als die Antwort eines Biochemikers. Auf einer Geburtstagskarte stand Folgendes zu lesen: Wissenschaftler haben errechnet, dass die Stoffe, aus denen der Mensch besteht, nur ein paar Dollar wert seien. Viel Wasser, wenig Substanz! Harold J. Morowitz, Biochemiker an der amerikanischen Yale University, wollte es jedoch genauer wissen. Statt Kohlen- und Wasserstoff, Kalk, Eisen und ähnliches zu berechnen, listete er die Tagespreise der komplexeren Verbindungen im menschlichen Organismus auf. Hämoglobin zum Beispiel, der rote Blutfarbstoff, schlug schon mit 2,95 $ zu Buche, das Enzym Trypsin mit 36 $, das Peptid Bradykinin gar mit 12.000 $, und so weiter. Als er den Preis für ein Gramm Follikelhormon ausrechnete, verschlug es ihm den Atem: 4,8 Millionen $. Dies sei ein Geschenk für Leute, die schon alles hätten, schrieb er in sein Tagebuch. Doch damit nicht genug, denn ein Gramm Prolaktin würde den Verbraucher sogar 17,5 Millionen $ kosten. Kurz und gut, der durchschnittliche Mensch von 75 kg Gewicht, der aus knapp 25 kg Trockenmasse besteht, wäre je nach Tagespreisen aus dem Katalog mit um die 60.000.000 $ zu bewerten – die Schwierigkeit, aus Pülverchen und Essenzen Herz, Haut und Haar zusammenzubasteln, noch nicht mit gerechnet. Aber ob das ausreicht? Gott der Schöpfer misst jedem Menschen einen unschätzbaren Wert bei. In der Bibel lese ich, wie Gott zu einem jeden von uns durch seinen Propheten sagt: Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. (Jes 43, 4-5) So gesehen geht der Wert eines Menschen gegen unendlich. Ich wünsche allen, die sich für unbedeutend halten, und die an ihrem Selbstwert zweifeln, dass sie nicht auf fragwürdige Berechnungen hereinfallen oder falschen Wertvorstellungen hinterher jagen, sondern in der Liebe Gottes ihren wahren Wert erkennen.
Peter Kanehls
16.08.2020
Es kommt auf den Blickwinkel an
Neulich in Eisleben in Sachsen-Anhalt: Wir sind als Gruppe auf den Spuren Martin Luthers unterwegs. Hier wurde er geboren und hier ist er nach einem bewegten Leben 1546 auch gestorben. Die Stadtführung stellt die Vergangenheit und die aktuelle Lage der Stadt einander gegenüber. Eine Zahl lässt mich nicht los: 3% der Menschen sind evangelisch. In der „Lutherstadt Eisleben“, so der offizielle Titel, scheint die Kirche auszusterben. Fast möchte ich in das allgemeine Lamento einstimmen: „Gottes Reich ist mitten unter uns?! Tatsache ist, dass die Kirche in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Dass unsere Gemeinden erst älter und dann kleiner werden. Ich glaube nicht, dass sich das Blatt noch wenden wird. Die Wahrheit ist: Die Kirche in Deutschland steht kurz vor dem Aus. Ich weigere mich zu glauben, dass ich als Mitglied meiner Kirche etwas tun kann. Ich bin überzeugt, man kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen: Gott kümmert sich um uns.“ Auf Nachfrage wird unser Guide persönlich. Ihr Vater war hoher Stasi-Offizier. Sie selbst ging zur Kirche, durfte nicht studieren, war sogar im Gefängnis damals. Seither engagiert sie sich leidenschaftlich für ihre Kirche. Der Grund: Sie hat einen Perspektivwechsel vollzogen und Halt im Glauben gefunden. Sie ist fest davon überzeugt: „Gott kümmert sich um uns. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen: man kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Ich bin überzeugt, dass ich als Mitglied meiner Kirche etwas tun kann. Ich weigere mich zu glauben, die Kirche in Deutschland steht kurz vor dem Aus. Die Wahrheit ist, dass sich das Blatt noch wenden wird. Ich glaube nicht, dass unsere Gemeinden erst älter und dann kleiner werden, dass die Kirche in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Tatsache ist: Gottes Reich ist mitten unter uns.“ In der Tat! Wir bekamen in Eisleben einen lebendigen Eindruck davon.
Peter Kanehls
09.08.2020
Luxus der Genügsamkeit
Heinrich Böll erzählt einmal, wie ein eifriger Tourist im südlichen Europa mit einem einheimischen Fischer ins Gespräch kommt. Der hatte seelenruhig in der Sonne gedöst, bis jener Tourist eilfertig auf ihn eindrang. Während dieser nicht verstehen kann, wieso der Fischer am hellen Tage auf der "faulen Haut" liege, versucht jener dem Touristen klar zu machen, dass der Fang, den er heute bereits gemacht habe, für zwei oder drei Tage reiche. Der Tourist will den Fischer dazu überreden, seine Zeit besser auszunutzen, wieder und wieder zum Fang hinauszufahren, um mehr und mehr Fisch zu fangen, sein Geschäft zu vergrößern, Mitarbeiter einzustellen, eine Fischereiflotte aufzubauen. Wozu das gut sein solle, fragt der Fischer, und der Fremde antwortet mit stiller Begeisterung: Dann könnten Sie hier in der Sonne dösen - und auf das herrliche Meer blicken. Darauf der Fischer: Aber das tu ich ja schon jetzt!
Anekdote gegen den Stress nennt Heinrich Böll diesen kurzen Dialog, und er trifft damit noch immer den Nerv unserer Zeit. Höher, schneller, weiter - wohin soll das führen? Bescheidenheit, Genügsamkeit, Zufriedenheit scheinen vergessen zu sein. Die Bibel ist da bemerkenswert deutlich: Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. (Hebr 13) Der Tourist meint: Man muss es sich leisten können, in der Sonne zu liegen und zu dösen - und das heißt, man muss es sich verdienen. Der Fischer "leistet" sich den "Luxus", sich an seinem Fang genügen zu lassen, und döst in der Sonne, mit sich und der Welt zufrieden. Aber weder Leistungsdruck noch Selbstzufriedenheit tun uns auf die Dauer gut. Zwischen diesen beiden Extremen leben wir als Christen von dem, was Gott uns schenkt. Jesus sagt: Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum dass ihr euch seiner Herrschaft anvertraut und so lebt, wie er sich das von euch wünscht, dann wird euch von ihm all das zufallen, was ihr zum Leben braucht. (Mt 6).
Peter Kanehls
02.08.2020
Der Weg ist hier. Kommt nur herein!
Im Urlaub die Seele baumeln zu lassen, wer wollte das nicht. Der unvergleichliche Heinz Erhardt schreibt dazu: „Ich geh im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Da kann man noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem andern, und an den Bäumen hängt Blatt für Blatt Urlaub – schön, dass man ihn hat!“ An Urlaub konnten der Hirte Suskewiet, der Aalfischer Pietjevogel und der triefäugige Bettler Schrobberbeeck, von denen Felix Timmermans erzählte, nicht einmal im Traum denken. Als sie im kalten flämischen Winter als heilige drei Könige bettelnd über Land zogen, begegnete ihnen am späten Abend ein knarrender Kirmeswagen, der von einem alten Mann und einem Hund gezogen wurde. Drin saß eine schmale, junge Frau mit bleichem Gesicht, die war schwanger. Dies rührte die rauen Männer, und sie beschlossen, diesen Leuten, die offenbar ebenso schlecht dran waren, wie sie, etwas von der erbettelten Habe abzugeben. Wie sie an die Wagentür klopfen und der Alte ihnen öffnet, sagt Pietjevogel: „Wir sind gekommen, um Euch nach dem Weg zu fragen.“ – „Der Weg ist hier, kommt nur herein.“, antwortet der Alte. Die Szene kommt uns seltsam bekannt vor. Das liegt an dem weihnachtlichen Inventar – die heilige Familie, Hirten und Könige. Sie sind Repräsentanten jener Menschen, die auf der Suche sind. Sie wandern durch diese Welt und fragen danach, wie wir denn leben können. In ihnen begegnen wir auch uns selbst, denn wir sind Habenichtse. Alles, was von wahrem Wert ist – Glück und Liebe und Vertrauen – haben wir nicht, sondern es wird uns geschenkt. Der, der in jener Nacht geboren wird, wird einmal von sich sagen: „Ich bin der Weg“ (Joh 14, 6). Jesus lädt dazu ein, den Weg mit ihm zu gehen, sich mit ihm auf die Lebensreise zu begeben und zu erleben, wie Gott leere Hände füllt und Leben segnet. Diese Einladung gilt auch uns: „Der Weg ist hier, kommt nur herein.“ Möge die Urlaubszeit uns Raum und Möglichkeiten geben, das zu erfahren. Mögen die Kirchen am Wegesrand uns zu einer kurzen Rast verleiten, und mögen die Gottesdienste am Urlaubsort überraschende Impulse für uns bereithalten.
Peter Kanehls
26.07.2020
Mein Taschenkreuz
Neulich am Brottresen. Am Brottresen zahlen viele Leute noch immer mit Bargeld. Die paar Euro, und zumeist krumme Beträge, sind mitunter schwierig aus dem Portemonnaie zusammen zu klauben. Die kleine alte Dame vor mir tut sich sichtlich schwer mit den Münzen, hat aber den Ehrgeiz, den Betrag für das Brot passend zu zahlen. Kennt man ja so von früher. Und während sie kramt und wühlt, rutscht die Geldbörse ihr doch aus der Hand, und ein Schwall von Münzen ergießt sich auf den Boden. Ach du meine Güte! Sofort springen zwei, drei Leute ihr zur Hilfe. Sie selbst findet das alles peinlich. Die Verkäuferin guckt gequält. Auch ich sammle ein paar Münzen auf und gebe sie der Frau zurück. Dann entdecke ich das Kreuz. Ein kleines nur zwei Zentimeter langes lateinisches Kreuz aus Plastik hatte seinen Platz in dem Portemonnaie, die Frau trägt es scheinbar immer bei sich. Das macht mich neugierig. Als sie sich beruhig und ihren Einkauf getätigt hat, spreche ich sie an und frage nach dem Kreuz, und ob es damit eine besondere Bewandtnis habe. Ob ich das wirklich wissen will, fragt sie mich. Na klar, ich meine es ernst. Wenn das so ist, sagt sie, dann möchte sie gern meine Adresse haben, denn sie will mir die Antwort aufschreiben, da sie jetzt losmüsse, ich würde dann von ihr hören. Und so bekomme ich wenige Tage später tatsächlich einen Brief folgenden Inhalts:
Das Kreuz in meiner Tasche – es hat nur einen Sinn:
Mich an meinen Herrn zu erinnern, wo ich auch gerade bin.
Es birgt keinen magischen Zauber und ist auch kein Talisman,
der mich vor Unheil und Krankheit bewahren und schützen kann.
Es ist auch kein offenes Bekenntnis das mich als Christ ausweist;
nur ein Zeichen der inneren Bindung an IHN durch seinen Geist.
Und sucht meine Hand in der Tasche wonach es auch immer sei,
so mahnt mich das Kreuz stets aufs Neue: CHRISTUS, er macht dich frei.
Es ruft mich, nur IHM zu leben, IHM nachzufolgen allein;
denn dem Kreuz verdanke ich alles, ich kann mich des Lebens freun.
Erinnern soll es mich täglich an all seine Gnadengaben,
die ich teile mit allen, die glauben und IHN zum Meister haben.
Das Kreuzchen in meiner Tasche bekundet mir, wo ich auch bin,
dass Christus der Herr meines Lebens und ich sein Eigentum bin.
Erstaunliches inniges Bekenntnis einer Christin, die mir Einblick gewährt in ihr persönliches Glaubensleben. Eine Frau, die ihr Christsein nicht vor sich her trägt, sondern es im Innersten ihres Herzens hütet, nicht um ihren Glauben zu verbergen, sondern um ihn mitten im Alltag zu leben. Jesus Christus ist mir nah; er ist nur ein Gebet weit entfernt und geht mit mir durch diesen Tag diese Woche, dieses Leben. Wenn nun der Alltag grau und widerspenstig ist, die Mitmenschen unfreundlich sind, die Gefühle Achterbahn fahren, und das Leben wie eine Last an mir hängt, dann hilft mir so ein Zeichen, mich zu besinnen, woher ich kommen und wohin ich gehöre – es sei am Brottresen, oder wo auch immer. Was hindert mich, mir so ein Zeichen anzufertigen, oder mir ein kleines Kreuz zu besorgen, das ich bei mir trage, und das mich erinnert und mich ermutigt, mein Christsein nicht nur zu behaupten, sondern zu leben – denn darauf kommt es an.
Peter Kanehls
19.07.2020
Vergeben, nicht vergessen
Wohin mit meinem Ärger? Was fang ich an mit den Verletzungen? Wo bleib ich ab mit meiner Enttäuschung? Seltsame Fragen, oder? Doch manchmal begegnen sie mir noch, die Klischees vom frommen Kirchgänger. Da heißt es, dass Christen sich nicht streiten, niemals aggressiv werden dürften, immer freundlich und friedlich seien. Heilig und harmlos, sozusagen. Finden wir uns darin wieder? Ich hoffe, nicht. – Hhm. Hat nicht Jesus die Sanftmütigen selig gepriesen? (Mt 5,5). Nun, ja, aber Jesus konnte auch sehr energisch werden, als er nämlich die Händler und Geldwechsler vom Tempelgelände verjagte und so überdeutlich Kritik an der Kommerzialisierung des Glaubens und der Religion übte. Dies jedoch wurde ihm über Jahrhunderte hinweg sozusagen als „Ausreißer“ ausgelegt, als die menschliche Seite Jesu, die man getrost meinte vernachlässigen zu können. Kirche hat dann über lange Zeit hinweg unter einer Art Aggressionshemmung gelitten und als Folge davon nicht selten den „Schwamm-drüber-Blues“ bekommen. Will sagen: Unbearbeitete Konflikte, auch wenn sie längere Zeit zurück liegen, schwelen unter der Oberfläche und beeinträchtigen das Miteinander. Es kostet Kraft, sie zu verdrängen – so zu tun, als wäre da nichts – und einfach immer irgendwie weiterzumachen. Das macht einen Menschen irgendwann mürbe, geschweige denn eine Gemeinde oder gar eine Kirche. Ist es nicht so: Kleine Kinder meinen noch, wenn sie die Augen verschließen, sind die Dinge, die sie ängstigen, einfach weg. Erstens stimmt das nicht, und zweitens sind wir keine kleinen Kinder mehr. Machen wir uns nichts vor! Der Volksmund sagt: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder.“ – Wirklich nicht? Ich sage ja nichts Neues, wenn ich behaupte, dass wir eben nicht in einer heilen Welt leben, und dass Konflikte, Streit, Aggressionen, Wut, Angst, Verletzungen uns immer wieder zu schaffen machen – es sei im Kleinen oder im Großen. Was nun einmal in der Welt ist, können wir nicht wieder zurück nehmen und ungeschehen machen. Was also tun? Wie damit umgehen? Vielleicht möchten wir „mit gleicher Münze zurückzahlen“ oder einfach „das Weite suchen“? Was also, wenn unsere Unvollkommenheiten mal wieder zu Differenzen führen und wir aneinander schuldig werden? Wenn wir jedes Mal zurückschlügen oder uns von jedem abwendeten, der sich (in unseren Augen) etwas hat zuschulden kommen lassen – wir wären womöglich bald allein. Zu sagen: Ist mir egal, ich nehme jeden Menschen, wie er ist, das könnte uns zu Komplizen ihrer Schuld machen. Jesus geht den „dritten Weg“ und spricht an dieser Stelle von Vergebung. Das vielleicht bekannteste christliche Gebet, das Vaterunser – die Wort, die Jesus seinen Jüngern als Leitfaden für ihr Gebetsleben gegeben hat – drückt das so aus: „...und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern...“(Mt 6,12) – wir haben das oft gehört. Aber wie geht das? Otto Hermann Pesch (bis 1998 Theologe in Hamburg) sagt dazu: „Einem Menschen vergeben heißt nicht, das was er getan hat, für ungeschehen erachten, nicht wahrhaben wollen oder schlicht vergessen. Vergeben kann unter Umständen bedeuten, gerade nicht zu vergessen. Vergeben heißt: die Vergangenheit eines anderen keinen Einwand dagegen sein zu lassen, dass ich ihn annehme. Vergebung heißt nicht das Ja zu einer vergangenen Schuld, wohl aber das Ja zu einem Menschen mit seiner vergangenen Schuld.“ Ich denke: Gottes JA gilt nicht in erster Linie dem, was wir leisten und tun, sondern sein JA gilt dem, was wir in seinen Augen immer schon sind: Gottes Geschöpfe, seine geliebten Kinder. Zu sehen, dass das nicht nur für mich gilt, sondern auch für meinen Nächsten, wäre eine gute Übung, nicht den „Täter“ und die „Tat“ miteinander zu verwechseln. Sich zu erinnern, dass nicht nur andere Menschen Vergebung brauchen, sondern auch ich darauf angewiesen bin, könnte mir helfen, nicht in der „Opferrolle“ zu verharren. So will ich JA sagen nicht zuerst zu dem, was einer getan hat, sondern vor allem zu meinem Gegenüber – er oder sie ist ein Mensch „wie du und ich“. Oder um es mit Paulus zu sagen: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ (Röm 15,7)
Peter Kanehls
12.07.2020
Spuren im Sand
Mit Gott zu reden ist nicht nur Pastoren möglich, so wie ich einer bin, und es braucht dazu nicht unbedingt eine Kirche. Aber ein offenes Herz und die Bereitschaft, sich den Eindrücken zu stellen, die sich während des Gebets zeigen, das braucht es schon. Bilder, Gedanken und Gefühle, oder - soll ich sagen - Impulse, die so entstehen, sind manchmal, ohne dass sich das beweisen lässt, wie Antworten Gottes. Was ich damit sagen will, lässt sich sehr schön an den berühmten „Spuren im Sand“ nachlesen. Ich meine jeden vielzitierten kurzen Text, der seit Jahren auf Kalenderblättern, Glückwunschkarten, und in christlichen Zeitschriften zu finden ist. Sie kennen ihn nicht? Die Deutsch-Kanadierin Margaret Fishback-Powers schreibt:
„Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Gott.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten,
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?
Da antwortete er:
Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen."
Originalfassung des Gedichts Footprints © 1964 Margaret Fishback Powers. Deutsche Fassung des Gedichts Spuren im Sand © 1996 Brunnen Verlag, Gießen.
Bemerkenswert ist die Geschichte hinter diesen Worten. Margaret Fishback-Powers erlebte eine unbeschwerte Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof in Kanada, entdeckte ihre musische Begabung und begann, Gedichte zu schreiben. Als junge Frau wurde sie von einem Blitzschlag schwer verletzt, eine Liebesbeziehung ging in die Brüche, und frustriert kehrte sie in ihr Elternhaus zurück. Doch dann lernte sie Paul Powers kennen und lieben. Am Abend nachdem sie beschlossen hatten, zu heiraten, schrieb sie 1964 die „Spuren im Sand“ nieder. Der Text fand Aufnahme in ihre Hochzeitszeitung. Die Ehe der Beiden wurde im Laufe der Jahre immer wieder von Sorgen um die Familie und beruflichen Schwierigkeiten belastet. Nach zwanzig Jahren, Margaret Fishback-Powers hatte die „Spuren im Sand“ längst vergessen, entdeckte sie die Worte ihres Textes in einer Buchhandlung in Washington und erinnerte sich. Jemand anders hatte sich als Autor ausgegeben. Ein langwieriger Urheberrechtsstreit setzte ein, den sie letztlich – nicht zuletzt mit Hilfe der alten Hochzeitszeitung - für sich entscheiden konnte. Wichtiger aber wurde ihr die Erkenntnis, die sie schon Jahre zuvor in ihrem Gedicht niedergeschrieben hatte, und die ihr nun halfen, ihr Leben im Rückblick neu sehen zu lernen: Gott war immer bei ihr und würde es immer sein, egal, was geschieht. Dadurch innerlich bewegt und im Vertrauen auf Gott bestärkt, beschloss sie, die Beziehung zu Gott, die in den vergangenen Jahren flach und müde geworden war, zu erneuern und – ja – wieder zu beten.
So individuell diese Geschichte ist, so allgemein ist ihre Botschaft. Gott lässt uns nicht hängen und verlässt uns nicht. Mag sein, dass fühlt sich nicht immer so an. Mag sein, wir tragen selber dazu bei, dass wir uns von Gott verlassen erleben. Nicht alles, was wir tun, sagen, denken, ist menschlichem Miteinander förderlich und kann daher auch von Gott nicht gut geheißen werden. Deshalb ist die Suche nach Gott und das Gespräch mit ihm mehr, als eine fromme kirchliche Übung für solche Menschen, „die das wohl nötig haben“, wie mir manchmal gesagt wird. Nein, das Gespräch mit Gott – also das Gebet – kann uns helfen, unser Leben im Licht der Liebe Gottes verstehen zu lernen und Seinen Zuspruch zu hören. Ich nehme dazu heute Worte der Bibel zur Hilfe und lese bei dem Propheten Jesaja:
So spricht Gott der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. (Jes 43, 1-5 i. A.)
Peter Kanehls
05.07.2020
Kleine Wunder - Großes Glück
Neulich meldete sich bei mir jemand aus dem Urlaub zurück. Hatte sich eine Auszeit auf einer Nordseeinsel genommen, da dort die Corona-Fälle gegen Null tendierten. Wie schön, dachte ich, dass es in diesen verrückten Zeiten doch auch möglich ist, Abstand zu gewinnen und sich zu entspannen. Wohl dem, der das kann! „Ich kann für mich sagen, dass mir diese ‚besondere’ Zeit, abgesehen von den Hiobsbotschaften in der Welt, gut getan hat.“, sagte mir derjenige noch. Das finde ich bemerkenswert, denn es macht deutlich, dass Anteilnahme an dem Geschick der von Corona betroffenen Menschen und Urlaub zur persönlichen Erholung sich nicht ausschließen müssen. Und ich muss gestehen: Auch ich habe in diesem Frühjahr nicht nur Belastendes, sondern auch Beglückendes erleben können. Muss ich deshalb ein schlechtes Gewissen haben? Ich es nicht vielmehr so, und jedes Ding hat zwei Seiten? Mir fällt dazu das Märchen von dem Bauern ein, dessen Pferd eines Tages davon lief und nicht zurück kehrte: „Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen; welch ein Unglück! Der Landmann antwortete: Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück — und brachte ein Wildpferd mit. Da sagten die Nachbarn: Erst läuft dir das Pferd davon — und dann bringt es noch ein zweites mit! Was hast du bloß für ein Glück! Der Bauer schüttelte den Kopf: Wer weiß, ob das Glück bedeutet? Das Wildpferd wurde von seinem ältesten Sohn eingeritten; dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: Welch ein Unglück! Der Landmann gab zur Antwort: Wer will wissen, ob das ein Unglück ist? Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs ins Dorf und zogen alle jungen Männer für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück — mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen! Der Bauer: Wer sagt denn, dass dies ein Glück ist?“
So könnte man endlos weitererzählen. Glück und Unglück wechseln sich ab – je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir die Ereignisse betrachten. Weit davon entfernt, sich die Dinge schön zu reden, will ich mir nichts vormacht, sondern den Tatsachen ins Gesicht sehen. Ich will die Corona-Krise keinesfalls verharmlosen. Doch es gilt auch dies: Das Leben geht weiter, und trotz aller Bedrückung gibt es auch viel Grund zu Dankbarkeit und Freude. Nicht selten sind es die kleine Wunder, die mir helfen, den Blickwinkel zu verändern und mich neu auszurichten: Der Duft von Holunderblüten, ein Glas Honig von meinen Bienen, ein versöhnliches Wort nach einer Auseinandersetzung, eine liebevoll Zuwendung, wo ich sie gar nicht mehr erwartet habe – ich denke, jedem von uns fallen Beispiele dafür ein. Man muss sie nur sehen wollen. Der Bauer in dem Märchen – womöglich konnte er die Wechselfälle des Lebens so scheinbar gelassen hinnehmen, weil er sich an eine Herzenshaltung gewöhnt hatte die Paulus im Römerbrief so schildert: „Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet.“ (Röm 12,12) Ich meine, dies ist ein tragfähiges Fundament auch für uns. Wer darauf baut, den kann so leicht nichts erschüttern. Menschen, die auf Gott hoffen und darin froh sind, die sich durch Bedrängnisse nicht von ihm trennen lassen, und die schließlich nicht aufhören, das Gespräch mit Gott zu suchen, also zu beten, die wissen sich in jeder Lebenslage in Gottes Hand und vertrauen darauf, dass sie mit seiner Hilfe das Ziel ihres Lebens erreichen werden. Was unterwegs Glück ist oder Unglück, das erweist sich oft erst im Nachhinein. Gott aber kennt unsere Wege und lässt uns nicht allein, bei ihm sind wir geborgen. In seiner Perspektive sieht manches, das uns jetzt bekümmert, weniger bedrohlich aus, erst recht in diesen „besonderen“ Zeiten, wie sich der Urlaubsheimkehrer ausdrückte, da sich Glück und Unglück in kurzer Folge abwechseln. Mit Gottes Hilfe können wir als Menschen der Hoffnung fröhlich sein, standhaft Bedrängnissen widerstehen und im Gespräch mit unserem himmlischen Vater bleiben, können uns erholen, entspannen und neue Kraft bekommen. Trotz Corona und wegen Corona und ohne schlechtes Gewissen.
Peter Kanehls
28.06.2020
Alles hat seine Zeit
Im Sitzungszimmer hier im Pastorat in Dänischenhagen hängt ein Bild des Fotografen Jean Guichard. Jean Guichard ist für seine Fotos historischer Leuchttürme an der bretonischen Küste bekannt geworden. Am 21. Dezember 1989 ließ Jean Guichard sich mit einem Hubschrauber an das äußerste Ende der Bretagne fliegen, um den Leuchtturm La Jument aufzunehmen, der auf einem Felsen etwa 20 Kilometer vor der Küste der Bretagne steht und seit 1911 Wind und Wetter trotz. Unfassbare Naturgewalten werden in diese Region entfesselt. Bricht sich die sturmgepeitschte See an dem winzigen Felsen, erreichen die sich auftürmenden Wassermassen nicht selten die Höhe des Leuchtturms – immerhin 47(!) Meter. An diesem Tag herrschte Windstärke 10, und es waren spektakuläre Aufnahmen zu erwarten. Und tatsächlich gelangen den Fotografen wundervolle Bilder. Erst als sie entwickelt waren, entdeckte Guichard den Leuchtturmwärter von La Jument, wie er eben aus der Tür tritt, während sich hinter ihm eine Riesenwelle aufgebaut hatte, die er, in der Tür stehend, gar nicht sehen konnte. Was war aus ihm geworden? Hatte er die Welle überlebt? Schnell stellte sich heraus, dass Théodore Malgorne im letzten Moment die Tür schließen und dem Unheil entgehen konnte. Hätte er nur eine Sekunde gezögert, er wäre ins Meer gerissen worden und umgekommen.
Für mich ist dieses Bild mit seiner dramatischen Geschichte eine vielleicht etwas ungewöhnliche Erinnerung daran, dass alles seine Zeit hat, wie es in der Bibel heißt. Will sagen, dass auch wir nicht „alle Zeit der Welt“ haben, sondern nur die uns zur Verfügung stehenden Jahre, von denen wir nicht wissen, wie viele es sind. Je älter ich werde, desto deutlicher wird mir, dass ich nun nicht mehr alles das schaffen werde, was ich mir vorgenommen oder was ich mir gewünscht habe. Umso wichtiger ist es, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Was will ich noch? Was brauche ich nicht mehr? Wofür will ich mich noch einsetzen? Wofür kann und will ich dankbar sein? Und worauf kann und will ich auf keinen Fall verzichten? Alles hat seine Zeit. Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht ich?
Während der Kirchengemeinderrat tagt, sitze ich meistens so, dass ich das Bild des Leuchtturms mit der Riesenwelle gut sehen kann. Je nach Thema und Tagesverfassung fühle ich mich manchmal dem Leuchtturmwärter nahe – unwissend und mit kleiner Kraft mitten in einem Meer aus zerstörerischen Wassermassen. Wenn es dann „hoch hergeht“, ist es wichtig, sich nicht mitreißen zu lassen, sondern nur einen Schritt zurück zu tun, die Tür zu schließen und das Chaos auszusperren. Nicht selten nämlich tobt der Sturm in(!) mir. Dann halte ich mich an das Bild von dem Turm. Standfest und unerschütterlich seit über hundert Jahren strahlt er Ruhe aus, schützt seine Bewohner und weist denen da draußen auf dem Meer den Weg vorbei an Felsen und Sandbänken in den sicheren Hafen. In diesen Momenten wird mir der Turm zu einem Bild von Gott, der mich einhüllt und beschützt, wie gewaltig der Sturm auch sei. Dazu fallen mir Worte eines Liedes von Martin Pepper ein, der von Gott sagt: „Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit Dir, Friede mit Dir!“
Alles hat seine Zeit, wie der Prediger Salomo sagt: „Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.“ (Prd. 3,7f.) Den richtigen Augenblick zu erkennen und zu entscheiden, was jetzt zu tun, zu sagen, zu lassen ist – das wünsche dir und mir. Dazu die Erfahrung, dass der Sturm der Gedanken und Gefühle sich legt, und wir bei Gott zur Ruhe kommen und Frieden finden können. Der Leuchtturm La Jument wurde übrigens 1991 automatisiert und sein Leuchtturmwärter Théodore Malgorne aufs Festland versetzt. Durch das spektakuläre Bild mit der Riesenwelle im Hintergrund erinnern wir uns bis heute an ihn und an die eine Sekunde, die ihn von der Katastrophe trennte, und vor der ihn der eine Schritt zur rechten Zeit zurück in den Turm bewahrte.
Peter Kanehls
21.06.2020
Wie schön dass du geboren bist
Rolf Zuckowski, altgedienter Liedermacher, geschätzt von jung und alt, hat 1981 ein Geburtstagsgratulationslied geschrieben, das wir wohl alle kennen oder wenigstens irgendwo schon Mal gehört haben: „Heute kann es regnen, stürmen oder schnei’n, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein.“ Kein Kindergeburtstag, an dem dies nicht gesungen wird. Mir gefällt besonders der Refrain: „Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. Augenzwinkernd wird hier ein Paradox ausgesprochen, denn kann man jemanden vermissen, der gar nicht geboren ist? Wohl kaum. Wer nicht zur Welt gekommen ist, den gibt es nicht. Das aber können wir voneinander nicht wirklich denken. Der tiefere Sinn dieser Gratulation liegt in der Tatsache, dass wir auf der Welt sind. Niemand kann das rückgängig machen. Wie es aussieht, soll es wohl so sein, dass wir da sind. Mehr noch: Wie es scheint, war jemandem daran gelegen, dass wir zur Welt gekommen sind. Mit Worten eines anderen Liedes: „Nicht durch Zufall steh ich da, Gott hat mich gemacht.“ Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass keiner von uns aus Versehen hier ist, dass jedes Leben etwas zu bedeuten hat, und dass wir auf niemanden verzichten könnten. Wäre ja auch schlimm! Wer wollte so etwas entscheiden? Jeder von uns, jede von uns ist ein einzigartiges, unverwechselbares und wunderbar geschaffenes Menschenkind, von Gott gewollt, von Gott geliebt.
Wir erfahren diese Liebe zumeist durch andere Menschen. Keiner würde auf die Idee kommen, ein Geburtstagsgratulationslied für sich alleine zu singen. Es sind Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, die dem Geburtstagskind ihre Aufmerksamkeit, ihre Wertschätzung und ihre Sympathie schenken. Will sagen: Wir mögen dich, wir brauchen dich, wir freuen uns über dich und mit dir.
Es gibt wohl niemanden, den das kalt lässt. Diese Liebe hilft uns, auch in Regen, Sturm und Schnee zu bestehen, das sind Bilder für die mancherlei Schwierigkeiten im Leben. Oder wie es in einem neueren Lied heißt: „Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich, sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh“. Das berührt und bewegt uns und macht uns froh und glücklich. Man sieht es uns an, denn wir strahlen es aus.
Ich möchte Dich und alle, die in ihrem Alltag bedrückt und bekümmert, oder durch die Corona-Krise seit ein paar Wochen ihres Lebens nicht mehr recht froh sind, - ich möchte Dich einladen, Dir vorzustellen, dass Gott Dich ansieht und für Dich dieses Geburtstagsgratulationslied von Rolf Zuckowski singt. Ungewöhnlich, ich weiß. Aber einen Versuch ist es Wert. Und so hört sich das dann an: „Wie schön, dass Du geboren bist, ich hätte dich sonst sehr vermisst.“ Ich glaube fest daran, dass Gott sich über Dich freut und Dir seine Sympathie schenkt, das ist sein Mitleiden an deinem Scheitern, und sein Mitfreuen an deinem Gelingen. Und dass Er es sich nicht nehmen lässt, Dich zu begleiten heute und Morgen und an jedem neuen Tag, ganz gleich, welches Wetter herrscht und wie es um Dein Herz bestellt ist. Er hätte im Leben nicht auf Dich verzichten wollen.
Peter Kanehls
14.06.2020
Gottes Ansichtskarten
Im Gespräch mit kritischen Zeitgenossen höre ich gelegentlich, dass Glaube, wie ihn die christlichen Kirchen vertreten, heutzutage unmodern oder allenfalls noch etwas für Kinder und alte Leute sei. Mal abgesehen von dem Werturteil über Kinder und alte Leute - wie steht es damit bei Dir? Ich denke, es gibt in unserm Alltag mehr Glauben, als uns bewusst ist. Was ich meine: Du beißt beherzt in das Brötchen, das Du heute Morgen am Brottresen bekommen hast – woher weißt Du, dass es nicht vergiftet ist? Zuvor hast Du Dich mit Elan an den Frühstückstisch gesetzt – woher weißt Du, dass der Stuhl Dich trägt? Und beim Blick aus dem Fenster wächst in Dir die Vorfreude, denn heute wird das Wetter gut werden. Sicher? Für das Wetter gibt es Kriterien, für den Stuhl kannst Du auf Deine Erfahrungen zurückgreifen, und für das Brötchen – nun, da musst Du einfach vertrauen. Mit dem Glauben ist es nichts anderes: Kriterien, Erfahrungen, Vertrauen benennen recht gut die Bedingungen christlichen Glaubens. Was aber sagst Du dazu: „Einen ganzen Tag lang im Sommer warteten fünfzig Urlauber eines Busses aus Flensburg am Großglockner“, dem höchsten Berg Österreichs, „um diesen zu sehen. Sie sahen indessen nur Nebel und Wolken und graues Geröll und ein wenig Schnee. So sehr sie auch schauten mit Augen und Gläsern, es war nichts zu sehen. Jedoch zu zweifeln an diesem Berg, an seinem realen Vorhandensein, sah keiner sich abends genötigt, als sie den Bus dann bestiegen. Selbst Herr Koch, der ansonsten nur glaubt, was er sieht (mit eigenen Augen), sonst nichts, hatte fünf Ansichtskarten des großen Glockners in Farben gekauft und schrieb hinten drauf von unvergesslichen Eindrücken. Und hatte selber gar nichts gesehen als Nebel.“ Diese Anekdote von Lothar Zenetti will sich keinesfalls über Bergtouristen lustig machen. Ist es nicht so, dass wir, was Glauben angeht, nicht selten wie diese Bergurlauber sind? Nur, dass wir- anders als sie – weil wir Gott nicht sehen können, kurzerhand an seinem realen Vorhandensein zweifeln, und Glauben mit Nichtwissen verwechseln? Nun gibt es aber doch diese faszinierenden „Ansichtskarten“. Das sind die Eindrücke, die andere vor uns bekommen haben; die Erfahrungen, von denen sie zu erzählen wissen; die Begegnungen, die sie berührt haben und durch die sie bewegt worden sind, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und Christen zu werden. Glauben bedeutet nicht nur, im Nebel zu stochern, sondern sich diese „Ansichtskarten“ Gottes anzuschauen. Glauben heißt, sich mit ihnen vertraut zu machen, um den kennen zu lernen, von dem wir momentan außer ein wenig Wolken und Geröll nicht viel zu sehen bekommen. Wir können wissen, wer Gott ist. Und wie Glauben geht, können wir wissen. Das Geheimnis liegt im Vertrauen auf die Erfahrungen, die andere vor uns gemacht haben. So gesehen ist die Bibel wie eine ganze Sammlung von „Ansichtskarten“, die uns einen Eindruck davon vermitteln, wie es ohne Nebel um uns, um unsere Welt und um Gott bestellt ist. Das Wagnis des Glaubens liegt darin, sich einzulassen, die Worte, Bilder und Ereignisse der Bibel im eigenen Herzen zu bewegen, sie ernst zu nehmen und auf sie zu hören als auf den, der dahinter verborgen durch sie zu uns redet. Wenn es gut geht, wird Herr Koch (der aus der Anekdote) zum Großglockner zurückkehren und bei gutem Wetter irgendwann einen Blick auf ihn werfen können. Die Ansichtskarten schenken ihm in der Zwischenzeit die Gewissheit, dass da nicht Nichts ist – und hat er es nicht auch irgendwie gespürt? Geht es uns anders? Warum folgen wir nicht unserer Sehnsucht, vertrauen den Worten und Bildern der Bibel als einer Ansicht von Gott, und vertrauen ihm, auch wenn der Himmel über uns momentan Wolken verhangen ist. Petrus beschreibt das in seinem ersten Rundbrief an die jungen Gemeinden damals so: Ihn, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude. (1. Petr 1,8) Ich bin mir sicher: Unser Glauben läuft nicht ins Leere.
Lass Dich sich nicht von zuviel Nebel irritieren, sondern bleib aufmerksam für die „Ansichtskarten“ Gottes!
Peter Kanehls
07.06.2020
Drei Brüder in der Krise
Corona verändert uns. Manche Menschen sind übervorsichtig geworden in letzter Zeit und bleiben auf Abstand. Andere entdecken ihre renitente Ader und werden, je länger die Krise dauert, umso ungehaltener. Es begann mit dem Toilettenpapier. Die Regale in den Geschäften waren wie leergefegt. Auch Frischhefe war lange nicht zu bekommen und ist noch jetzt mitunter Mangelware. Betroffen hat mich die Preisentwicklung beim, Mund-Nase-Behehelfsschutz gemacht, die sogenannten „Masken“. Während sie früher für ein paar Cent zu bekommen waren, verlangen dubiose Händler mittlerweile astronomische Preise. Das finde ich unanständig. Neulich im Supermarkt huschte eine Frau an mir vorbei, sah mich kurz an – ich hatte den Eindruck, wir kennen uns – nickte kaum merklich und hastete weiter. Ich wollte zurücklächeln, jedoch was soll ein Lächeln unter der „Maske“? Mag ja sein, es wird immer noch gelächelt, aber man muss schon sehr genau hinsehen, wenn man das Lächeln an der Augen erkennen will. Insgesamt ist das Einkaufen aber eine ziemlich ernst Sache geworden.
Corona verändert uns. Wir achten stärker auf das, was wir unbedingt brauchen, und machen uns bewusst, was wir loslassen und worauf wir verzichten können. Mir ist in diesen letzten Wochen auch deutlich geworden, dass wir in der Krise einander brauchen. Keiner wird sie für sich allein überwinden. Das ist leicht gesagt, aber schwer getan, und liegt womöglich daran, dass wir womöglich Angst haben, als Verlierer zurück zu bleiben, oder irgendwie leer auszugehen. Eine Legende erzählt von einem Vater und seinen drei Söhnen. Der Vater stirbt und hinterlässt 17 Kamele und ein Testament, in dem er die Aufteilung der Kamele unter die Kinder genau festgelegt hat. Der älteste Sohn soll die Hälfte bekommen, der zweite Sohn ein Drittel und der jüngste ein Neuntel. 17 Kamele, die Hälfte geht nicht, ein Drittel geht nicht, ein Neuntel geht nicht. Die Zahl 17 lässt sich weder durch zwei noch durch drei noch durch neun teilen. Darum geraten die Söhne nach dem Tod des Vaters in einen heftigen Streit. Schließlich kommt ein Fremder geritten. Er hört den schwierigen Fall an und stellt nach einigem Überlegen sein eigenes Kamel dazu. Nun sind es 18 Kamele, und die Aufgabe lässt sich lösen. Der älteste bekommt die Hälfte, also neun Kamele, der zweite ein Drittel, also sechs Kamele, und der dritte Sohn erhält ein Neuntel, also zwei Kamele. Nachdem die Kamele so aufgeteilt sind, machen sie alle eine wunderbare Entdeckung: neun und sechs und zwei sind zusammen 17 Kamele. Das vom Fremden dazu gestellte Kamel bleibt für ihn übrig. So hat sich der Fremde mit seinem Gut eingebracht, die Schwierigkeit damit gelöst und sein Kamel doch behalten. Verblüffend, oder? Mag sein, dass das mathematisch nicht ganz sauber gerechnet ist und ist doch eine schöne Geschichte, denn sie beschreibt den Königweg der christlichen Nächstenliebe. Wir Christen sind zutiefst davon überzeugt, dass der himmlische Vater die Seinen nicht im Stich lässt. Er sorgt für sie und segnet sie. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber doch immer so, wie es am Ende gut für uns ist. Darum wird, wer sich engagiert – es sei, um einen Streit zu schlichten, oder um den Sprachlosen eine Stimme zu geben, um die Traurigen zu trösten, oder die Verzagten zu ermutigen – darum wird, wer sich für eine bessere Welt und ein menschenwürdiges Leben einsetzt, nicht leer ausgehen. Mag sein, das ist nicht leicht getan, und neue Konflikte sind vorprogrammiert. Wer sich aber engagiert, wird – wie der Fremde und die drei streitenden jungen Männer – die wunderbare Entdeckung machen, dass er nicht ärmer wird, sondern reicher. Jesus sagt in der Bergpredigt bei Matthäus: „ Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch!“ (Mt 7,12) Mag uns dies den Weg durch die Krise weisen und uns helfen, sie zu überwinden.
Peter Kanehls
31.05.2020
Ist da jemand?
Anfang Mai hätten wir in unserer Kirche Taufe und Konfirmation feiern wollen. 29 Mädchen und Jungen fieberten dem großen Fest entgegen, das nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Ich finde das noch immer irritierend, und es betrübt und schmerzt mich, die Jugendlichen und ihre Familien so im Ungewissen zu lassen. Schon im Frühjahr hatten wir uns auf die Vorstellung der Konfirmanden gefreut. Sie sollte in einem fröhlichen, kreativen Gottesdienst Ende März stattfinden. Die Vorbereitung dazu hat mich bewegt. Jugendliche Mitarbeiter hatten vorgeschlagen, die Frage nach Gott in die Beschäftigung mit einem Song von Adel Tawil zu kleiden. „Ist da jemand?“, fragt Adel Tawil. „Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich: Ist da jemand, der mein Herz versteht?“ Es ist nicht ganz klar, ob er nach Gott fragt, oder nach einem Menschen der ihn vorbehaltlos annimmt, ihm beisteht und auch in Schwierigkeiten bei ihm bleibt, nach einer Beziehung, die trägt und durch nichts zu erschüttern ist. Mit Beziehungen zu anderen Menschen haben wir so unsere Erfahrungen. Niemand kann auf Dauer für sich allein leben. So sind wir gemacht – schon ganz am Anfang der Bibel heißt es: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.“ (Gen 2,18) Hierin spiegelt sich etwas vom biblischen Menschenbild wider, das davon ausgeht, dass niemand vollkommen, sondern in jedem Falle ergänzungsbedürftig ist. Erst zu Zweit sind wir ganz, läuft die Sache rund, macht das Leben Spaß, finden wir Erfüllung.
Das fühlt sich gut an, wenn die Sonne scheint und unser Alltag gelingt. Doch wenn es in der Beziehung knirscht? Die Viruskrise allerdings stellt alle unsere Beziehungsprobleme in den Schatten und verändert unser Lebensgefühl radikal. Einerseits rücken wir in Solidarität zusammen, andererseits – wenn schon alles in Frage steht, beginnt auch die Suche nach dem, was unser Leben trägt, ihm Sinn und Ziel gibt. „Ist da jemand?“ – oder sind wir – auch zu Zweit – auf uns allein gestellt? Ist die Welt leer, oder gibt es eine Absicht hinter den Dingen? Für mich hält die Bibel Antworten bereit, Antworten die man sich selbst nicht geben kann. Sie erzählt davon, wie Gott zur Welt kommt, unbeeindruckt davon, ob Menschen nach ihm fragen, oder nicht. Sie spricht davon, wie Gott uns entgegenkommt, sich zu erkennen gibt, sich uns vorstellt, uns zur Erfahrung wird. Als Mose den brennenden Dornbusch entdeckt, begegnet er dem lebendigen Gott, und als er ihn nach seinem Namen fragt, erhält er zur Antwort: Ich bin der Ich-bin-da (Ex 3,14). Ein Gott, der da ist, der mitgeht, der acht gibt, der voller Hingabe und Leidenschaft für uns alles daran setzt, mit uns zusammen zu sein – so stellt er sich vor. Und später dann setzt er noch eins drauf: In Jesus Christus nämlich zeigt er uns sein unverwechselbares Gesicht und lässt uns erfahren, was ihm am Herzen liegt. Ich glaube, dass er uns vorbehaltlos annimmt, uns beisteht, uns durchträgt und durch nichts zu erschüttern ist. Mit Worten von Adel Tawil: „Da ist jemand, der dein Herz versteht - und der mit dir bis ans Ende geht - wenn du selber nicht mehr an dich glaubst - dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt - und dich sicher nach Hause bringt - immer wenn du es am meisten brauchst - dann ist da jemand!“ Oder um es mit Paulus zu sagen: „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ (Apg 17,27f.)
Dies sei nun nicht nur unseren Konfirmanden gesagt, sondern allen, ganz gleich, ob ihnen heute die Sonne scheint, oder der Himmel für sie momentan ohne Farben ist. Ich wünsche uns ermutigende Begegnungen mit ergänzungsbedürftigen Menschen – nicht selten sind wir es selbst, dazu die Erfahrung der schützenden und helfenden Nähe Gottes – ein frohes und gesegnetes Pfingstfest.
Peter Kanehls
24.05.2020
Gedanken des Friedens
Heute will ich mit einem Bibelwort beginnen. Es kommt aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Bei Jeremia lesen wir: „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe.“ (Jer 29,11) Klingt nach Ermutigung, und das soll es auch sein. Die Lage des jüdischen Volkes damals konnte schlimmer nicht sein: Allenthalben Krise, Krankheit, Katastrophe. Der König Nebukadnezar hatte Israel mit militärischer Gewalt besetzt, Jerusalem belagert und erobert, die Oberschicht nach Babylon deportiert, und sich daran gemacht, das Land auszuplündern. Besetzt, unterdrückt, tributpflichtig – rechtlos, elend, ungewiss. „Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben“, sagt Rilke in einem seiner großen Herbstgedichte und fasst für mich die Stimmung in Worte, die sich im Land und bei den Deportierten damals ausgebreitet haben muss. Machen wir uns klar: Die in Babylon waren vom Tempel in Jerusalem getrennt, der Tempel war zerstört. Da Gott den Seinen versprochen hatte, dass sie ihn ebendort im Tempel sicher finden würden, hieß das jetzt für sie: Wir sind nicht nur fern unserer Heimat und leben in Elend und Gefangenschaft, sondern wir sind damit zugleich fern von Gott und also verloren. Für die im Lande hieß das: Gott ist fort. Keine Möglichkeit mehr, ihm zu opfern, ihn zu loben, sich seiner zu versichern. Zugleich zur äußeren Katastrophe öffnete sich ein innerer Abgrund, und ihnen blieb nichts, als Verzweiflung. Die Welt war aus den Fugen – nichts blieb mehr, wie es einmal war.
Weit davon entfern, die Corona-Pandemie mit der babylonischen Eroberung Israels zu vergleichen, drängt sich mir, wenn ich die aktuellen Nachrichten wahrnehme, doch so etwas wie ein Déjà-vu auf. Krise, Krankheit, Katastrophe – das sind die Stichworte, die den Zustand unserer Welt zurzeit recht treffend benennen. Je länger der Lockdown aber dauert, und je lauter der Ruf nach Lockerungen der Corona bedingten Beschränkungen wird, desto deutlicher wird auch die Frage nach der Perspektive im Persönlichen, im Gesellschaftlichen und im Blick auf die Weltgemeinschaft der Völker und Staaten. Viel Ängstliches ist da zu hören, und mancherlei Resignation steht auf, aber auch Rücksichtslosigkeit und Unvernunft machen sich breit. Selten noch ist die Frage nach Gott zu hören, und auch unter gläubigen Menschen macht sich mitunter das Gefühl einer gewissen Gottesferne breit. Genau hier aber sprechen Jeremias Worte mich an, und seine Botschaft bleibt nicht nur eine Ermutigung in der Vergangenheit, sondern wird zur Perspektive für die Gegenwart. Was auch immer wir uns an Begründungen zurechtlegen mögen, welche Theorien auch immer zur Erklärung derzeitiger Verhältnisse herhalten müssen – Gott ist nicht fort, er ist nicht unerreichbar, nicht unzugänglich. Frieden, Zukunft, Hoffnung sind die Stichworte seiner Botschaft an die verzweifelten damals. Er legt sie heute auch uns ans Herz. Heute wissen wir, dass in Babylon die Grundlagen einer jüdischen Schriftgelehrsamkeit gelegt wurden, die dem jüdischen Volk geholfen hat, durch alle schrecklichen Stürme der Geschichte hindurch zu überleben. Wir wissen nicht, weshalb das so und nicht anders ging, Israel aber durfte erfahren, dass Gott treu ist. Er stiftet Frieden, eröffnet Zukunft, schenkt Hoffnung. So auch uns. Gott ist heute nicht mehr auf einen Tempel angewiesen, nein, er wünscht sich von uns ein offenes Herz und einen wachen Geist. So werden wir gleichsam zu Gottes Tempel, ER bekommt Raum in uns und ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wohl allen, die sich Gott anvertrauen. Wohl allen, die sich dies zueigen machen und die mithelfen, dies auch zu verwirklichen im Miteinander und Füreinander. „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe.“
Pastor Peter Kanehls
15.05.2020
Desiderata
Vielen ist sie schon einmal begegnet, die sog. Lebensregel von Baltimore, angeblich aus der Old Saint Paul’s Church von 1692. Heute wissen wir, dass Max Ehrmann, ein deutschstämmiger Amerikaner und Rechtsanwalt im Bundesstaat Indiana in den USA, in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dieses Gedicht verfasst hat. 1959 hat der Pastor der Old St. Paul’s Church diese Worte im Rahmen einer Sammlung seiner Gemeindebriefe veröffentlicht und so zur Popularität dieser auch „Desiderata“ genannten Dichtung beigetragen. Das Original ist in englischer Sprache geschrieben und vielfach übersetzt worden.
Ich lese dieses Gedicht heute für alle, die durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Umstände und Einschränkungen bedrückt, genervt oder erschöpft sind; für alle, die im Homeoffice arbeiten oder in Quarantäne festsitzen; für alle, die sich fragen, was man tun kann oder lassen sollte, und was noch gilt in dieser Zeit, da schon beinahe alles fragwürdig erscheint.
„Gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast
und sei des Friedens eingedenk, den die Stille bringen kann.
Vertrage Dich mit allen Menschen, möglichst ohne Dich ihnen auszuliefern.
Äußere Deine Wahrheit ruhig und klar und höre andern zu,
auch den Geistlosen und Unwissenden; denn auch sie haben Ihre Geschichte.
Meide laute und aggressive Menschen. Für den Geist sind sie eine Qual.
Wenn Du Dich mit andern vergleichst, könntest Du bitter werden
und Dir nichtig vorkommen, denn es wird immer Menschen geben
die größer oder geringer sind als Du.
Freue Dich Deiner Leistungen wie auch Deiner Pläne.
Bleibe weiter an Deinem eigenen Weg interessiert,
wie bescheiden er auch sei.
Im wechselnden Glück der Zeiten ist er ein echter Besitz.
In Deinen geschäftlichen Angelegenheiten lasse Vorsicht walten,
denn die Welt ist voller Betrug.
Doch soll das Dich nicht blind machen für vorhandene Rechtschaffenheit.
Viele Menschen bemühen sich, hohen Idealen zu folgen,
und überall ist das Leben voller Heldenmut.
Sei Du selbst. Vor allem heuchle nicht Zuneigung.
Und sei, was die Liebe anlangt, nicht zynisch.
Denn trotz aller Dürre und Enttäuschung ist sie doch ewig wie das Gras.
Nimm freundlich und gelassen den Ratschluss der Jahre an
und gib mit Würde die Dinge der Jugend auf.
Stärke die Kraft des Geistes, damit er Dich bei unvorhergesehenem Unglück schütze.
Aber quäle Dich nicht mit Gedanken. Viele Ängste
kommen aus Ermüdung und Einsamkeit.
Neben einem gesunden Maß an Selbstdisziplin sei gut zu Dir.
Lebe in Frieden mit Gott, wie auch immer Du IHN verstehst.
Was auch immer Dein Mühen und Dein Sehnen ist:
Halte in der lärmenden Wirrnis des Lebens mit Deiner Seele Frieden.
Trotz aller Falschheit, trotz aller Mühsal und all der zerbrochenen Träume
ist es dennoch eine schöne Welt.
Sei vorsichtig. Und strebe danach, glücklich zu sein.“
In diesem Sinne. – Bleiben Sie zuversichtlich!
Pastor Peter Kanehls
10.05.2020
Die beiden Schwestern
„Erstens kommt es anders, und zweites, als man denkt.“ – dieser Ausspruch meiner Großmutter fällt mir ein, wenn ich mir die Nachrichten der letzten Tage vor Augen führe. Täglich werden Lockerungen der Corona bedingten Einschränkungen angekündigt, nur um sie die dann gleich wieder zu kritisieren. Entscheidungs- und Bedenkenträger reichen sich die mediale Klinke in die Hand, preschen vor und rudern zurück. In die Vorfreude auf größere Spielräume wächst bei mir aber auch die Verunsicherung. Was gilt denn jetzt? Ab wann? Und wo? Und wie lange? Die einen nehmen es gelassen; andere verstehen die Welt nicht mehr. Die Schriftstellerin Mascha Kaléko schildert folgende Szene:
„In meinem Hause wohnen zwei Schwestern.
Fragt man die beiden, wie es denn geht?
Lächelt die eine: ‚Besser als gestern!’
Aber die andere seufzt voller Sorgen:
‚Besser als morgen, besser als morgen.’“
Das kommt mir bekannt vor, und ich fühle mich verstanden. Es ist nämlich so, dass diese beiden Schwestern auch bei mir wohnen. Sie tragen die Namen Optimismus und Pessimismus. Je nach Tagesform ist mir die eine oder die andere Schwester näher – aber sympathisch ist mir die Erstgenannte.
Das Leben gleicht einer Achterbahn: Mal geht’s aufwärts, Mal geht’s abwärts. Und wir mitten drin. Die Coronakrise lässt uns das einmal mehr spüren. Wir hoffen alle, dass wir bald wieder in die Normalität zurückkehrten können, was auch immer das im Einzelnen heißen mag. Für mich steht da an erster Stelle, dass wir uns wieder ungezwungen und ohne Furcht vor Infektionen begegnen können. Und dass wir in unseren Kirchen wieder Gottesdienste feiern dürfen, die diesen Namen verdienen. Denn Gott zu loben mit Mundschutz, ohne Gemeindegesang und auf Abstand im kleinen Kreis, das ist zwar nicht unmöglich, aber nicht gerade erhebend.
Die Bibel spricht von Schwierigkeiten, kennt Durststrecken und weiß um Widerstände. Was Menschen Schlimmes und Schreckliches erlebt haben – die Bibel weiß darum. Was mir gefällt ist weniger dies, dass die Katastrophen menschlichen Lebens nicht ausgeblendet werden, als vielmehr das, dass mir eine Perspektive geboten wird, und ich bei dem was mir Angst macht, nicht stehen bleiben muss. „Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.“, heißt es im Hebräerbrief. „Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.“ (Hebr 10,35f.) So glauben ich immer noch, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält und uns dazu. Ohne dieses Vertrauen müsste sich ein Abgrund auftun, der alles verschlingen würde. Nein, dieses Vertrauen werfe ich nicht weg, denn es trägt mich auch durch die Widerstände der Krise, und es hilft mir, meinen Blick zu weiten – nicht nur um mich selbst zu kreisen, sondern auch andere zu sehen.
Es lohnt sich, Gott zu vertrauen – denn er hat sich selbst uns anvertraut in Jesus Christus. Bei ihm können wir erfahren, was zum Leben hilft und uns gut tut. Mag sein, dazu gehört ein wenig Übung. Worte der Ermutigung, Gesten der Aufmerksamkeit, Nächstenliebe – aber auch dies: Sich vertraut zu machen mit dem Buch, das von Gott erzählt und uns hilft, ihn kennen- und mit ihm leben zu lernen.
Die beiden Schwestern gehören zur Familie. Wir sollten sie nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander versöhnen, indem wir sie einladen, wozu der Hebräerbrief uns ermutigt: Sich Gott anzuvertrauen, zuversichtlich zu leben, und sich in Geduld zu üben in den mancherlei Herausforderungen des Alltags.
Bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet.
Pastor Peter Kanehls
03.05.2020
Ich brauche die Bibel
Schön, dass Sie unterwegs hier vorbeischauen!
Wir leben in verwirrenden Zeiten voller Sorgen, Widersprüchlichkeiten und Befürchtungen. Viele Menschen fragen sich, was uns denn Halt und Perspektive geben kann. Da fällt mir ein Zettel von Jörg Zink in die Hände. Jörg Zink, 2016 im Alter von 92 Jahren gestorben, war Theologe, Pastor und Publizist. Er ist den Älteren unter uns vielleicht vom Wort zum Sonntag in der ARD oder als Sprecher beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Erinnerung. Seit 1965 veröffentlichte er seine eigene Übersetzung des Neuen Testaments und arbeitete unermüdlich daran, christlichen Glauben so zur Sprache zu bringen, dass Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts Gott kennenlernen und seiner Liebe in Jesus Christus begegnen können. Der Zettel enthält folgende Worte:
„Es gibt Menschen, die die Bibel nicht brauchen.
Ich gehöre nicht zu ihnen.
Ich habe die Bibel nötig.
Ich brauche sie, um zu verstehen,
woher ich komme.
Ich brauche sie, um in dieser Welt
einen festen Boden unter den Füßen
und einen festen Halt zu haben.
Ich brauche sie, um zu wissen,
dass einer über mir ist
und mir etwas zu sagen hat.
Ich brauche sie, weil ich gemerkt habe,
dass wir Menschen in den entscheidenden Augenblicken
füreinander keinen Trost haben
und dass auch mein eigenes Herz
nur dort Trost findet.
Ich brauche sie, um zu wissen,
wohin die Reise mit mir gehen soll.“
Soweit Jörg Zink. Ich kann ihm darin gut folgen, denn es geht mir ähnlich. Ich brauche die Bibel und mache wieder einmal die Erfahrung, dass durch die Worte, Bilder und Geschichten hindurch Gott nahe ist. Dieser Tage lese ich das Markusevangelium. Es hat 16 Kapitel – wenn ich täglich eins lese, und sonntags zwei, dann bin ich in zwei Wochen einmal den Weg mit Jesus gegangen, von seiner Geburt an bis hin zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung am Ostermorgen – eine faszinierende Geschichte.
Ich brauche die Bibel, denn in ihr kann ich erkennen, wer der Gott ist, von dem wir in der Kirche reden. Ich brauche die Bibel und den, von dem sie erzählt – der mich ermutigt, tröstet, und mir Halt und Perspektive schenkt in dem Fragen nach dem Woher, Wohin, Warum, Wozu.
Ich brauche die Bibel, damit Gott für mich nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern zu einer Erfahrung wird. Ich wünsche uns allen, dass täglich neu beim Lesen der Bibel aus dem alltäglichen Reden über Gott ganz bald ein vertrautes Reden mit Gott wird.
Bleiben Sie zuversichtlich und seien Sie gesegnet!
Pastor Peter Kanehls